ROSTOCK – HEILIGENDAMM – KÜHLUNGSBORN – WISMAR – SCHWERIN
–
Ich habe mich entschlossen, durch mein Land zu laufen.
–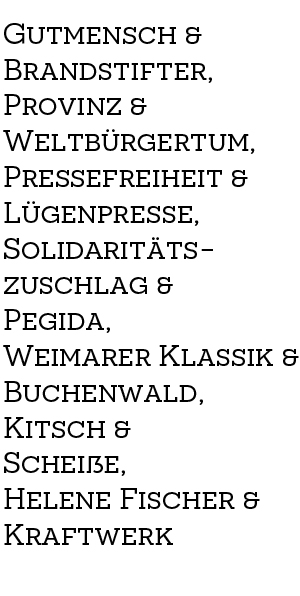
Deutschland hat mich angebrüllt in den vergangenen Monaten, es war nicht zu überhören: Schau’ dir doch mal an, was da so los ist, mit mir! In diesem Land, das nur drei Generationen, nachdem es die Welt in Brand und Trümmer gelegt hat, das angesehenste der Welt zu sein scheint, jedoch gleichzeitig in großen Teilen Europas, sagen wir mal, genervt wahrgenommen wird. Einem Land, in dem trotz hoher Bildung, Wohlstand und Sozialsystem die Angst und der Kummer wie in einem Fetisch leidenschaftlich ausgelebt werden. Einem Land, dem man in den vergangenen Monaten bei seiner Veränderung zusehen konnte, im Guten wie im Schlechten. Einem Land zwischen Biedermeier, Schuldfrage, Zweifel, Machermentalität und bürgerlicher Eigeninitiative. Einem Land zwischen immerwährender Vergangenheitsbewältigung, vorsichtiger Zurückhaltung, euphorischem Sommermärchen, offenherziger Willkommenskultur und dunkeldeutschem Fackelmarsch. Dieser Tage wird schrill, häufig sehr aggressiv und reißerisch hinaus posaunt, was den Menschen auf ihren Seelen liegt – man suhlt sich in den Sorgen und bemittleidet sich inbrünstig selbst, als gäbe es keinen Fleck auf der Erde, an dem es Menschen schlechter ginge, als zwischen ostdeutscher Gartenlaube und westdeutschem Taubenzuchtverein.
„Deutschland, bist du mein Kumpel oder ein Vollidiot?“
–
Das ist die Frage, die ich mir ständig stellen möchte. Es ist der Arbeitstitel einer Reise, zu der ich recht naiv und weitestgehend ohne vorbereitende Erfahrungsberichte aufbreche. Ich habe einen Presseausweis bei mir aber nie eine journalistische Ausbildung genossen. Ich habe viele Fragen im Gepäck aber bereits zu einigem eine recht definierte Meinung. Ich habe keine Ahnung was mich erwarten wird aber Hoffnungen, Befürchtungen und Vorstellungen für drei Reisen angehäuft. Die deutsche Ambivalenz und Widersprüchlichkeit, sie gilt es zu ergründen auf dieser Suche nach der Vereinbarkeit von Gutmensch & Brandstifter, Provinz & Weltbürgertum, Pressefreiheit & Lügenpresse, Solidaritätszuschlag & Pegida, Weimarer Klassik & Buchenwald, zwischen Kitsch & Scheiße und Helene Fischer & Kraftwerk.
–
–
Denke ich daran, was ich hier und heute für ein Leben führen kann und darf, ist Deutschland für mich ganz klar ein schätzendwerter Kumpel, ein Land wie ein guter und zuverlässiger Freund. Hier kann ich eine persönliche und individuelle Freiheit weitestgehend ungestört ausleben, mich selbst verwirklichen oder der Illusion davon mein Leben lang recht hedonistisch hinterher rennen.
Versuche ich an politisierende und mitreißende Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit zu denken, muss ich nicht lange überlegen: Mir fällt die Geste einer Regierung ein, die ich nie gewählt habe, die mir selten sympathisch war, aber die ich gerne einmal herzen und umarmen möchte für eine zutiefst humanistische Handlung, nämlich das Aufnehmen von Flüchtlingen, die sich aus welchen Gründen auch immer, über eine Autobahn pressen, während sich andere Regierungen über potentielle Schäden an den vorbei rasenden Autos sorgen. Nächstenliebe und Menschlichkeit; eine Selbstverständlichkeit – eigentlich. Kommt erst einmal hierher in Sicherheit, bevor ihr unter die Räder geratet, dann sehen wir weiter. Es klingt eigentlich sehr einfach und sehr nachvollziehbar, und weil es dann genau so nicht bloß angekündigt sondern auch umgesetzt wurde, habe ich meinen moralischen Schulterschluss mit einer Frau geübt, die mir in den zehn, zwanzig Jahren zuvor stets als kühl berechnende Naturwissenschaftlerin mit einem ausgezeichneten Machtgespür eher weniger sympathisch war. So kann man sich irren. Der Effekt war erstaunlich und sorgte allenthalben für ungläubiges Augengereibe: Spaliere klatschender Menschen, die lächelnd Care-Pakete verteilen. Das Wort der Willkommenskultur machte die Runde. Es zeigte sich ein Land und eine Gesellschaft, für die ich tiefe Dankbarkeit empfand.
Denke ich an die Vergangenheit dieses oft prahlsüchtigen und jähzornigen Volkes, kann ich es leider nicht immer als guten Freund im Geiste bezeichnen: Der Kaiser und sein Größenwahn. Hitler und sein Größenwahn. Die Deutschen und ihr Größenwahn.
Ich denke an das Foto eines Mannes in seiner vollgepissten Jogginghose: Ein Ostdeutscher im Trikot des gesamtdeutschen Fußballweltmeisters, der seinen Arm zum besoffensten aller deutschen Grüße erhebt, während sich neben ihm ein anderer Zeitgenosse fast verbiegt vor Lachen. Vor ihnen, im Bild von Martin Langer nicht sichtbar, fliegen gleichzeitig Molotowcocktails und Steine auf eine Unterkunft, in der Menschen gestrandet sind und – zunehmend verwahrlosend und verzweifelnd – auf Hilfe hoffen, während die überforderte und drucksende Polizei sie mit ebenjenen Hoffnungen und diesem stupiden und gewaltgeilen Mob alleine lässt. In diesem Fall ist Deutschland ein gigantisches Arschloch, eine verabscheuungswürdige Kackbratze auf mehreren Ebenen, so ekelhaft und beschämend dass man auswandern möchte nach, naja, egal, dahin wo solche Jogginghosen nicht anzutreffen sind. Dieses Bild entstand im August 1992, als ich acht Jahre alt war. Es wurde in Rostock-Lichtenhagen aufgenommen, während ein gewalttätiger Mob über mehrere Tage hinweg auf die Zentrale Annahmestelle für Asylsuchende losgeht. Das „Sonnenblumenhaus“ ist seitdem ein Begriff der deutschen Zeitgeschichte und steht repräsentativ für die dunklen Flecken in der ansonsten um verhältnismäßige Sauberkeit bemühten Geschichte der vergangenen fünfundzwanzig Jahre. Die Liste der dunklen Orte wird dieser Tage ständig erweitert um Begriffe wie Heidenau, Freital, Clausnitz. Diese Orte stehen sinnbildlich für einen neuen deutschen Neonazismus, eine neue deutsche Rechte, die in meinen Augen die eigentlichen Gründe liefert, sich ein paar Sorgen und Gedanken über dieses Land zu machen und an seiner Kumpeligkeit zu zweifeln. Das „Sonnenblumenhaus“ steht für mich am Anfang dieser Liste der schaurigen Orte und soll den Anfang meiner Reise bilden.
–
 Als ich dort aus der Bahn steige wird mir wieder einmal klar, dass Orten tatsächlich eine düstere Ausstrahlung anhaften kann. Ich bin mir an diesem ersten Morgen meiner Reise nicht sicher, ob es einen graueren und spröderen Ort auf dieser Welt geben kann – bunte und hochhaushohe Sonnenblumen hin oder her. Einige Plattenbauten vor einem kleinen Bau- und Möbelmarkt, eine Schnellstraße, ein Bahngleis mit Haltestelle – Fluchtmöglichkeiten immerhin! – endlose Pfützen auf rissigem Asphalt, Passanten in Regenmänteln und verhaltenen Minenspielen, keine Blätter an den Bäumen, ein akustischer Teppich geknüpft aus Verkehrsgeräuschen breitet sich über der Siedlung aus.
Als ich dort aus der Bahn steige wird mir wieder einmal klar, dass Orten tatsächlich eine düstere Ausstrahlung anhaften kann. Ich bin mir an diesem ersten Morgen meiner Reise nicht sicher, ob es einen graueren und spröderen Ort auf dieser Welt geben kann – bunte und hochhaushohe Sonnenblumen hin oder her. Einige Plattenbauten vor einem kleinen Bau- und Möbelmarkt, eine Schnellstraße, ein Bahngleis mit Haltestelle – Fluchtmöglichkeiten immerhin! – endlose Pfützen auf rissigem Asphalt, Passanten in Regenmänteln und verhaltenen Minenspielen, keine Blätter an den Bäumen, ein akustischer Teppich geknüpft aus Verkehrsgeräuschen breitet sich über der Siedlung aus.
Zu diesem deprimierenden äußerlichen Eindruck gesellt sich das Wissen darüber, was sich hier einst erbärmliches zugetragen hat: Ein Mahnmal der fehlenden Empathie, symbolisch festgehalten in einem Foto von zwei Komplettbeschränkten, die sinnbildlich für eine Gruppe von Menschen stehen, die offensichtlich alles vergessen haben – Verantwortung, Mitgefühl, die eigene Geschichte. Wenn der einzelne Mensch an sich ein recht schlaues und einfühlsames Geschöpf sein kann, wovon ich bei allem Pessimismus grundsätzlich ausgehe, dann dokumentiert dieses Foto doch auch sehr ansehnlich, wie dumm und verachtenswert er sich als Teil einer Gruppe geben kann. Und hier wo ich nun stehe, hat seinerzeit diese Gruppe gewütet, über Tage und Nächte hinweg. Sie haben Opfer gesucht und hier gefunden. Es hätte Tote geben können, doch auf schier unglaubliche Weise blieben diese aus. So poltert dieser Gebäudekomplex hier brutal ins Gemüt des Betrachters und strahlt diese zutiefst hässliche deutsche Geschichte aus.
–
Ich beginne zu laufen und es fühlt sich erleichternd an, diese Häuser hinter mir zu lassen. Kein einziges mal drehe ich mich um und bilde mir somit ein, dieses neudeutsche Mahnmal mit Nichtachtung zu strafen. Ich laufe bis zum Leuchtturm in Warnemünde, wo einige Hotels so aussehen wie die pauschalisierten Bettenburgen in Spanien, nur ohne Sonnenschirme und Sangria. Ich frage einen Hausmeister nach dem Weg in Richtung Heiligendamm, einer der wenigen heutigen Dialoge. Erstaunt ist er und macht große Augen – “Wirklich? Zu Fuß? Das ist schon ein ziemliches Stück Weg!” Immer wieder werde ich diesen Gesichtsausdruck in den kommenden Wochen sehen. Aus ihren Augen fragt auch immer eine ungläubige Stimme: “Warum?” Ich spüre, wie häufig mir nach diesen Dialogen hinterhergesehen wird und kann nicht behaupten, dass mir mein sturer Blick geradeaus sowie der unbeirrbare Schritt nicht gut täten. Wäre es nicht schön, am Meer entlang zu gehen? Der kurze Versuch, im Sand direkt an den Wellen entlang zu laufen, wird vom Gewicht meines Rucksacks jäh beendet bevor er richtig beginnt, weshalb ich wieder die offizielle Wanderroute auf festgetretenen Pfaden einschlage. Der Weg durch die oberhalb des Strandes gelegenen Wälder lässt das pochende Nachhallen des Sonnenblumenhaustrauerspiels allmählich leiser werden. Hier, bloß einige Kilometer von den Plattenbauten entfernt, rauscht das Meer sanft durch die Baumreihen und die Sonne malt fiebrig mit ihren wahllos geschwungenen Spotlights durch dramatische Wolkenformationen. Mir begegnen Jogger in quietschebunter Kleidung und gigantischen Kopfhörern, sowie Familien mit einem oder zwei Kindern, die die letzten Tage ihrer Osterferien hier verbringen. Ein älterer Mann auf einem Fahrrad überholt mich und ruft „Rostock ist in die andere Richtung!“ Ich kann mir keinen Reim darauf machen, was genau er mir damit sagen möchte und gehe weiter, pausenlos und kraftvoll auftretend, als müsste ich mich noch selbst motivieren – was ja tatsächlich der Fall ist. Diese Herangehensweise an das Gehen ist fast fatal: Es heißt, man solle nach jeder Stunde des Marschierens für eine fünfzehnminütige Pause sorgen. Das kann ich mit mir beim besten Willen nicht vereinbaren, denn nach einer guten Stunde laufen bin ich erst so richtig im Laufen angekommen. Eine Pause würde diesen Fluss zerstören. Also: Weiter, weiter, immer weiter, Oli Kahns Mantra vor das innere Auge geschrieben.
Ich laufe ohne Rast bis kurz vor Heiligendamm. Es ist früher Nachmittag als sich die Umrisse von Festzeltgarnituren und einem Ausschank auf einer Lichtung unweit vom Meer abzeichnen. Ich lege meinen Rucksack ab, bestelle ein Bier und bemerke den Schmerz. Ruhe, Alkohol und ein Blick in die Wellen entspannen Körper und Geist, beide Ebenen sind vollkommen außer Atem. Vier Stunden bin ich durchgelaufen, die Füße pochen drohend, Schultern und Nacken sind ein verkrampftes Gestrüpp. Die nächste Dummheit: Hastig und viel zu schnell trinke ich aus, denn ich will weiter, bevor mein Körper vollständig abgekühlt ist.
–
Ich gehe bis Heiligendamm, sehe die Grandhotels mit ihrem makellosen 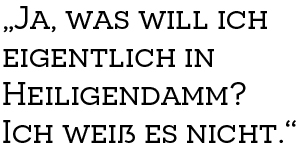 weißen Anstrich und erste verwunderte Blicke auf mich und meinen schlackernden Rucksack. Was will der hier? – springt mir alle paar Meter in einem Blick entgegen. Ja, was will ich eigentlich in Heiligendamm? Ich weiß es nicht. Die ehemals fixe Idee, den ersten Tagesmarsch hier zu beenden, noch nicht direkt dreißig Kilometer oder mehr zu laufen, um die Füße und den Körper langsam an die Aufgabe zu gewöhnen, und dabei einen Blick in ein Kaiserbadgrandhotel zu werfen, Wolfgang Büscher-mäßig die Überraschung in den Gesichtern der Portiers zu sehen, während ich nassgeschwitzt und abgekämpft einchecke – das alles ist beim Erreichen dieses Ortes keine befriedigende Vorstellung mehr. Der Weg zum Grandhotel endet abrupt vor einem massiv geschweißten Zaun und so muss ich einige hundert Meter zurück gehen, um dann über den Strand wieder auf den Wanderweg zu kommen. Dieses Hotel beansprucht also für sich, den Weg nicht an sich vorbeiführen zu lassen und deshalb bin ich sauer auf dieses Etablissement, auf diesen Ort, auf seine Ausstrahlung mit den perfekt rasierten Jungspunden in ihren Polohemden und Wet-Gel-Frisuren, die vor dem Eisentor stehen und lockere Konversation betreiben. Ich bleibe noch nicht einmal stehen, um die Entscheidung abzuwägen und gehe direkt wieder zurück wo ich mich in Richtung des Strands orientiere. Ich bereue diese erste Planänderung mit dem ersten Schritt in den Sand unterhalb des Hotels, denn ich spüre mit ihm die erste große Blase an meinem linken Fuß. Egal, jetzt nicht aufhalten lassen, bis nach Kühlungsborn wird es schon noch gutgehen.
weißen Anstrich und erste verwunderte Blicke auf mich und meinen schlackernden Rucksack. Was will der hier? – springt mir alle paar Meter in einem Blick entgegen. Ja, was will ich eigentlich in Heiligendamm? Ich weiß es nicht. Die ehemals fixe Idee, den ersten Tagesmarsch hier zu beenden, noch nicht direkt dreißig Kilometer oder mehr zu laufen, um die Füße und den Körper langsam an die Aufgabe zu gewöhnen, und dabei einen Blick in ein Kaiserbadgrandhotel zu werfen, Wolfgang Büscher-mäßig die Überraschung in den Gesichtern der Portiers zu sehen, während ich nassgeschwitzt und abgekämpft einchecke – das alles ist beim Erreichen dieses Ortes keine befriedigende Vorstellung mehr. Der Weg zum Grandhotel endet abrupt vor einem massiv geschweißten Zaun und so muss ich einige hundert Meter zurück gehen, um dann über den Strand wieder auf den Wanderweg zu kommen. Dieses Hotel beansprucht also für sich, den Weg nicht an sich vorbeiführen zu lassen und deshalb bin ich sauer auf dieses Etablissement, auf diesen Ort, auf seine Ausstrahlung mit den perfekt rasierten Jungspunden in ihren Polohemden und Wet-Gel-Frisuren, die vor dem Eisentor stehen und lockere Konversation betreiben. Ich bleibe noch nicht einmal stehen, um die Entscheidung abzuwägen und gehe direkt wieder zurück wo ich mich in Richtung des Strands orientiere. Ich bereue diese erste Planänderung mit dem ersten Schritt in den Sand unterhalb des Hotels, denn ich spüre mit ihm die erste große Blase an meinem linken Fuß. Egal, jetzt nicht aufhalten lassen, bis nach Kühlungsborn wird es schon noch gutgehen.
Direkt auf Höhe des Grandhotels sehe ich einen Mann am Strand entlang spazieren und bin mir sicher: Botho Strauß! Nein, diskutiere ich mit mir selbst, der lebt doch so zurückgezogen in der Uckermark, er kann es nicht gewesen sein. Aber vielleicht ja doch.
In Kühlungsborn dann an der Promenade trinkt man Aperol Spritz in einem für acht Euro Tagesmiete gegönnten Strandkorb und schaut mich an, wie man eben einen humpelnden Wanderer anschaut in einem Ort, an dem offensichtlich weniger gewandert wird, als in maritimen Sitzmöbeln zu faulenzen und mediterrane Cocktails durch den Strohhalm zu saugen. Die Smartphones und Tablets sind so allgegenwärtig, dass ich mich frage, warum man ans Meer fahren muss, um dort Newsfeeds und eMails zu lesen. Früher hat man sich unterhalten oder aktionslos in die Sonne geblinzelt, urteile ich besoffen vom eigenen Aktionismus und ziehe stur an den irritierten Blicken der scheinbar ausnahmslos deutschen Urlauber vorüber.
Derweil verdunkelt sich der Himmel bedrohlich und Windböen fegen erste Hüte von den Köpfen der Promenadenrestaurantgäste. Der Campingplatz ist am Ende des Ortes gelegen und nach annähernd panisch gehetzten letzten Metern werde ich dort mit großem Hallo und überaus freundlich begrüßt. Schroffheit hätte ich jetzt nicht ertragen, nicht mit diesen Füßen, nicht bei dieser Wetterlage. Ob sie noch einen Zeltplatz frei hätten, frage ich. Es wird für die kommenden Wochen meine Standardfrage sein. Immer wieder werde ich die gleiche, oft von einem Lachen begleitete Antwort erhalten: „Natürlich!“ Fast überall auf meiner Reise werde ich die Zeltsaison eröffnen, damit habe ich vorher nicht gerechnet.
Ich baue mein neu erworbenes 930-Gramm-ein-Mann-plus-Rucksack-Zelt in der hintersten Ecke der Zeltwiese auf, um durch die Hecken etwas Schutz vor dem etwaigen Sturm zu bekommen und kümmere mich zunächst mithilfe von Vaseline und Pflastern um meine malträtierten Füße. Mir fällt auf, dass das unbeschwerte Atmen, fernab des Rucksacks und des Bodenkontakts der Füße, mit der Gewissheit der zurückhelegten Kilometer, ein unvergleichlich erleichterndes Gefühl ist. Stolz werde ich wohl in diesem Moment gewesen sein, allerdings zu fertig um dies wirklich zu begreifen. Ich kann an nichts denken außer: Essen. Also humple ich zur Pizzeria am anderen Ende des Campingplatzes, wo ich das Schlimmste befürchte, denn dieses Lokal ist ein italienisch-deutsches Zeitfenster mit Blick in die 90er-Jahre: Terracottafarbene Fliesen von der Theke bis zur Toilette, Gianna Nanini popmusiziert aus den klobigen Lautsprechern der Stereoanlage über einen kleinen zentrierten Teich mit Sprudelstein und Goldfischen. Nebensaisonatmosphäre. Wider allen Befürchtungen ist die Pizza jedoch ein absoluter Hit. Zur Verdauung möchte ich noch etwas am Strand entlang spazieren. Weil ich hierfür zu erschöpft bin, lege ich mich einfach in den Sand. Als ich nach fünf Minuten drohe dort einzuschlafen, schlürfe ich zurück zu meinem Zelt und schlafe – erfüllt, erschlagen, ernüchtert – noch vor Sonnenuntergang ein.
Am nächsten Morgen bin ich überzeugt, alles falsch gemacht zu haben, was man am Start einer langen Wanderung falsch machen kann. Ich bin mit zu viel falsch gepacktem Gepäck viel zu schnell und viel zu weit auf einmal gegangen. Nun habe ich an beiden Füßen jeweils vier Blasen, die Sprunggelenke sind geschwollen und mein Rücken ist ein einziger verspannter Zustand. Aufgeben ist natürlich keine Option, also packe ich schnellstmöglich mein Zelt zusammen und bin ab kurz nach acht wieder auf dem Weg, der mich heute bis nach Wismar oder zumindest in dessen Nähe führen soll. Ich gehe entlang an riesigen Werbetafeln, die dazu anhalten, jetzt nicht die Traumchance auf ein Grundstück hier oben am Meer zu verpassen. Zutiefst hässliche Einfamilienhäuser sind auf die Banner illustriert, bereits hier trennen Zäune und Hecken Bauplatz von Bauplatz, Familie von Familie. Allgegenwärtig sind diese Neubaugebiete, an deren Sinn – sowohl auf ästhetischer als auch gesellschaftlich Ebene – gerne häufiger gezweifelt werden dürfte. Die Ortskerne, die oft aus wunderschöner Baudenkmalsubstanz bestehen, veröden und sterben aus, während um die Dorf- und Kleinstadtzentren herum immer mehr dieser hier beworbenen Einfamilienparks entstehen. Platz braucht der Mensch, für sein Carport und seinen akribisch gepflegten Rasen, Spiel-, Grill- und Sportplatz auf einer Wiese, für seinen Zaun, den er sich drum herum baut und eine Hecke, die blickdicht zusammen wächst und gedeiht, während er drinnen in seiner Einfamilienhausarchitektur sitzt und sich in einen süßen Biedermeier flüchtet.
Meine Abneigung gegen die modernen dörflichen Strukturen und Bebauungsweisen wird durch eine Beobachtung in meinem Heimatort befeuert, die ich einige Tage vor Beginn der Reise gemacht habe. Einige Meter neben meinem Elternhaus befindet sich ein Spielplatz. Er ist nichts Besonderes: Eine Rutsche, eine Schaukel, eine Wippe, ein Turm zum klettern. Gegenüber des Spielplatzes befindet sich eine Wiese mit zwei Grundstücken. Vor kurzem sind diese beiden Grundstücke von einer jungen Familie erworben worden. Auf der rechten Hälfte verwirklichen sie ihren Traum vom Eigenheim. Auf die linke Hälfte bauen sie ihren Kindern: Eine Rutsche, eine Schaukel, eine Wippe und einen Turm zum klettern. Wenn die Kinder nun im eigenen Garten spielen, können sie die anderen Kinder auf dem Spielplatz zehn Meter weiter sehen wie sie schaukeln oder rutschen oder wippen oder klettern. Eine frisch gepflanzte Hecke wird dies schon bald zu verhindern wissen.
Ich verlasse die Neubaugebiete von Kühlungsborn und bereits nach einer halben Stunde habe ich mich zum ersten mal verlaufen. Ich bin auf dem Weg hinauf zu einem Leuchtturm, den ich für einen anderen gehalten habe. Der für den Norden ungewöhnliche Anstieg drückt auf meine Blasen, die Erkenntnis vor der Infortafel, dass ich gute vier Kilometer Umweg laufen muss auf meine Laune. In Bastorf mache ich dann meine erste Rast an einer Tankstelle neben einem Schwarzlichtminigolfcenter. Der große Kaffee kostet hier 1,30€. Neben mir sitzen sechs Rentner an einem großen Tisch und diskutieren über Wasserpumpen. „Die Schwiegermutter wohnt ja oben, die duscht ja nicht so häufig wie die jungen Leute. Die müssen ja immer dreimal am Tag!“
Nach der heute früher gesetzten ersten Pause nun der gleiche Effekt wie am Tag zuvor: Schmerzen. Heute zusätzlich gewürzt durch die drückenden Blasen. Schonhaltung bewahrend, den Coffee-to-go Becher in der Hand während ich über Traktorspuren im Feld marschiere, schaffe ich es bis nach Rerik in eine Bäckerei. Ich frage, ob sie auch belegte Brötchen haben und die Bäckereifachverkäuferin lässt eine Lamentokassette erklingen: „Nä! Nur das was morgens da ist – und dann schmiere ich auch nicht mehr nach! Das sehe ich gar nicht ein! Ich hab’ gestern schon ein ganzes Blech weggeschmissen!“ Mitten in ihrer Ansprache drehe ich mich um und verlasse wortlos die Bäckerei. Was gehen mich dein Geschmiere und deine Bleche an, denke ich. Ein einfaches „Nein.“ hätte mir vollkommen genügt. Hunger, Durst, Schmerzen – bloß nicht diese Unterhaltung führen.
Ich bin vollkommen fertig und muss mir eingestehen, dass ich heute, jedenfalls zu Fuß, nicht bis nach Wismar kommen werde. Ich sehe eine Bushaltestelle und warte dort neunzig Minuten auf die nächste Möglichkeit, nach Bad Doberan zu gelangen. Aus Mangel an Menschen, die man ansehen oder mit denen man sich unterhalten könnte, schaue ich während der Wartezeit in die Sonne und versuche die Beine und Seele baumeln zu lassen.
In Bad Doberan laufe ich, nein, ich schleppe mich bis zum Bahnhof, der, wie so viele in den kommenden Wochen verschlossen und verriegelt vorgefunden wird. Auch hier warte ich eine knappe Stunde auf den nächsten Zug und überlege, ob ich mich nun wegen meines Ausweichens auf den Öffentlichen Personennahverkehr schämen soll, oder ob derlei Pragmatismus in Ordnung wäre. Ich komme zur dankbaren Erkenntnis: Je ne regrette rien. Es geht hier um eine Reise und um das Unterwegssein an sich. Wenn hierfür die Bahn oder der Bus benötigt werden, dann ist das eben so. Zudem bietet sich so die Möglichkeit, die jeweiligen Orte und damit die Menschen dort etwas genauer kennen zu lernen, was ja Teil meiner Reise sein soll. Menschen und Wälder, Charaktere und Denkmäler, Begegnungen und Beobachtungen. Alles klar also, die Bahnfahrten sind hiermit legitimiert und die Frage nach der Erlaubnis an mich durch mich wird sich in den nächsten Wochen nicht mehr stellen, hoffe ich.
Irgendwann kommt der Zug, er kommt so selbstverständlich und verlässlich wie alle Verkehrsmittel die ich benutze, und bringt mich bis nach nach Wismar. Das Hotel neben der Tittentasterstraße, die wirklich so heißt obwohl sie in keinem Straßenplan verzeichnet wäre, kostet heute natürlich doppelt so viel wie noch zwei Wochen zuvor im Internet. Auf die Frage an den Rezeptionisten, ob es nicht viel sinnvoller wäre, wenn sie mir das Hotelzimmer günstiger und direkt vermieten, anstatt bei einer Onlinebuchung Prozente an Hotelportale abzugeben, erhalte ich die Antwort: Ja, das stimmt. Aber das können sie jetzt nicht machen, es ist schließlich Wochenende. Moment, sage ich, es ist Donnerstag und der Rezeptionist sagt, dies zähle bereits als Wochenende. Ich lasse ihn an seiner Rezeption zurück und finde eine wundervolle Pension mit sehr netten Angestellten und zahle ein Drittel des Hotelpreises.
–
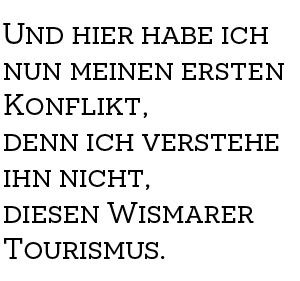 In Wismars Altstadt wird gehämmert und renoviert wohin man schaut – Welterbe muss gepflegt werden und da nimmt es Wismar offenkundig ziemlich ernst. Ernst sind auch die Blicke der Bedienungen in den vier Cafés und Restaurants, die ich Frage, ob sie auch auf den Terrassen bedienen. Nein, das tun sie nicht, ausnahmslos. Und hier habe ich nun meinen ersten Konflikt, denn ich verstehe ihn nicht, diesen Wismarer Tourismus. Es ist noch kühl und frisch aber die Sonne scheint und manch einer definiert die aktuelle Zeit bereits als Wochenende. Ich möchte also die Plätze und Straßen beleben, mir das dort stattfindende Treiben auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen von einer Terrasse aus ansehen – ich bin mir sicher: Alleine werde ich mit diesem Wunsch nicht sein! – aber niemand bedient im Außenbereich von Schwerin. Stühle und Tische sind mit Drahtseilen aneinander gebunden und es wird sich behäbig geweigert, mir einen dieser Plätze zur Verfügung zu stellen. Der einfache Wunsch, im Freien zu sitzen und ein Bier zu trinken, wird in der Verwirklichung zu einer knapp zweistündigen Suche. Irgendwann ist diese von Erfolg gekrönt und ich trinke ein 0,4 Liter Pils für 4,20€ auf der schattigen Veranda eines recht etepetetigen Restaurants.
In Wismars Altstadt wird gehämmert und renoviert wohin man schaut – Welterbe muss gepflegt werden und da nimmt es Wismar offenkundig ziemlich ernst. Ernst sind auch die Blicke der Bedienungen in den vier Cafés und Restaurants, die ich Frage, ob sie auch auf den Terrassen bedienen. Nein, das tun sie nicht, ausnahmslos. Und hier habe ich nun meinen ersten Konflikt, denn ich verstehe ihn nicht, diesen Wismarer Tourismus. Es ist noch kühl und frisch aber die Sonne scheint und manch einer definiert die aktuelle Zeit bereits als Wochenende. Ich möchte also die Plätze und Straßen beleben, mir das dort stattfindende Treiben auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen von einer Terrasse aus ansehen – ich bin mir sicher: Alleine werde ich mit diesem Wunsch nicht sein! – aber niemand bedient im Außenbereich von Schwerin. Stühle und Tische sind mit Drahtseilen aneinander gebunden und es wird sich behäbig geweigert, mir einen dieser Plätze zur Verfügung zu stellen. Der einfache Wunsch, im Freien zu sitzen und ein Bier zu trinken, wird in der Verwirklichung zu einer knapp zweistündigen Suche. Irgendwann ist diese von Erfolg gekrönt und ich trinke ein 0,4 Liter Pils für 4,20€ auf der schattigen Veranda eines recht etepetetigen Restaurants.
–
Wismar wirkt auf mich wie ein nordostdeutsches Münster, plus Fisch, minus Studenten. Die Menschen in den Straßen wirken wie Gäste, Besucher, Touristen. Café steht neben Eiscafé, steht neben Café, umrahmt sind sie von Zaras, H&Ms und allen anderen gängigen Fußgängerzonengeschäften wie MCGeiz, MCPaper, MCFit, MCDonalds. Die Geschäfte neonleuchten durch die Glasfassaden von phantastisch renovierten Altbauten. Wie so oft in den nächsten Wochen finde ich es hier auf ansehnliche Weise sehr hübsch – und möchte doch sofort wieder weiter.
In einem dieser traditionellen deutschen Kaufhäuser – in denen es zwar vieles gibt außer den konsumierenden Kunden, da dieser ja alles nötige und unnötige gemütlich und stressfrei, ohne anderen Menschen zu begegnen, von zu Hause aus bestellen kann – suche ich nach einer Jogging- oder Schlafanzughose. Meine erste Nacht habe ich in einer hautengen Jeans verbracht, Wärmewirkung von Schlafsack und Zelt im Norddeutschen Frühling, natürlich: Überschätzt. Die Suche nach einer gemütlicheren Hose ist nicht von Erfolg gekrönt. Die skinny Jeans wird für einige weitere Nächte meine Schlafhose bleiben. Wie bescheuert kann man eigentlich sein?
Abends esse ich dann Fisch im „Alten Schweden“. Alle Tische sind bereits belegt, deshalb setze ich mich mit der größtmöglichen Distanz zu einem Paar an eine sehr lange Tafel. Na, auch aus Bad Doberan in die große Stadt gefahren um mal einen guten Fisch zu essen? – denke ich über die beiden, denn nach Bad Doberan schauen sie irgendwie für mich aus. Dann höre ich, wie sie sich über Köpenick, den Simon-Dach-Kiez und dieses neue Restaurant in Mitte unterhalten. Wie ich wohl für sie aussehen muss?

Am nächsten Morgen sehe ich in Dorf Mecklenburg eine Reichskriegsflagge in einem Vorgarten wehen. Ansonsten alles ganz gewöhnlich hier: Gepflegtes Grün, gut gemeinte Gartendeko, „Hier wohnt Familie soundso“ sowie „Achtung vor dem Hunde!“ – Schildchen am Gartentörchen im Gartenzäunchen. Oben drüber flattert es schwarz-weiß-rot. Um meine Objektivität ist es schnell geschehen. Stattdessen: Ekel, Verachtung, Wut. Ich spucke dem Besitzer vor sein Carport.
Ansonsten macht mir das Laufen an diesem frühen und frischen Morgen ungeahnten Spaß. Ich habe zuvor in den Nachrichten gesehen, dass es in Erfurt schneit, während hier zwischen Wismar und Schwerin bei schneidend kalter Luft die Sonne scheint. So laufen sich die ersten zehn Kilometer phantastisch, auch weil mir deren Verlauf durch eine verlässliche Beschilderung keinerlei Rätsel gibt. Gegen Mittag komme ich mit meiner Straßenkarte, die lediglich die großen Fernwanderwege abbildet, nicht mehr wirklich voran. Eineinhalb Kilo Kartenmaterial trage ich bei mir, sie bleiben nicht durchgängig aber die meiste Zeit: Nutzlos. Nun stehe ich am Ende des markierten Wanderweges und sehe niemanden, der mir einen neuen weisen könnte. Also laufe ich auf der Hauptstraße weiter, auf dem Asphalt wenn niemand kommt, im schiefen Seitenstreifen bei Gegenverkehr. Nicht alle Autos und LKW machen einen Bogen wenn sie mich sehen, ihr Fahrtwind erschüttert mich auf dem rutschigen Grünstreifen, der Rucksack pendelt von rechts nach links. Zudem sehe ich einige unmissverständliche Handbewegungen und Gesten in meine Richtung, manch einer hupt. Plötzlich macht das Laufen keinen Spaß mehr. Unsicher und unbehaglich fühlt es sich an, ich muss hier weg, denke ich, doch nirgendwo am Horizont ist ein Ort zu sehen. Dann eine Kreuzung, immerhin, vielleicht der Beginn eines neuen Radweges? Das nicht, dafür etwas Klarheit in Form von Entfernungsschildern. Bad Kleinen: 5km. An dieser Kreuzung beginnen Felder und auf diesen Ackern sind bereits die ersten, tiefen Spuren in den schlammigen Boden gefahren. In diesen laufe ich nun weiter, das heißt ich versuche es, denn es ist sehr rutschig und mein Körperschwerpunkt hat Probleme mit seiner Geradlinigkeit. Ich spüre wie das ständige Rutschen an meinen Füßen scheuert, kann die Blasen fühlen wie sie reiben. Auf keinen Fall aber will ich weiter an der Hauptstraße entlang gehen.
Ich als unverkennbar weißer Mitteleuropäer muss hier an Familien auf der Flucht denken, an Trecks bestehend aus hunderten von Menschen mehrerer Generationen, die sämtliches Hab und Gut mit sich wuchten, dazu die Alten, Kranken, Schwachen stützen und allesamt ziemlich unverkennbar nicht mitteleuropäisch aussehen, unterwegs auf sämtlichen Wegen der Welt aber auch, und das ist ja der historische Fall, auf Ungarns Schnellstraßen. Sechs Kilometer Fußmarsch im Seitenstreifen einer mecklenburgischen Hauptstraße dürften jedem zur Einsicht genügen, dass es menschlich alternativlos gewesen ist, die Grenzen für eben jene Flüchtlinge auf Ungarns Straßen zu öffnen.
–
Ich stapfe durch die Äcker bis nach  Bad Kleinen, wo ich eine halbe Stunde auf dem Bahngleise sitze und meine nass geschwitzten Kleider in der Sonne trockne. Dann hält der Zug und ich fahre mit ihm die letzten Kilometer bis Schwerin, wo ich ein paar kleine Runden durch die Innenstadt drehe. Hübsch haben sie es hier, das muss ich sagen. Ich stehe in der Nähe des Schlosses und halte meine Straßenkarte in der Hand um mich ein letztes mal zu vergewissern, ob ich in die richtige Richtung gehe, als jemand neben mir stehen bleibt und mich auf wundervolle Weise anspricht: „Ja, möchte er irgendwo hin?“ Ich sage, ich wüsste es bereits – zum Campingplatz – und lasse ihn es mir dennoch erklären. Dann tritt er einen Schritt zurück und legt los: So etwas wie mich gäbe es ja heute gar nicht mehr, mit Bergstiefeln und auf infanteristische Weise unterwegs. Er salutiert und haut zackig die Hacken zusammen. Jahrgang 1936 sei er und wirkt dabei zwanzig Jahre jünger. „Ja, nie geraucht und so einen Quatsch gemacht!“ Er hat ein spitzbübisches Grinsen und kommt vom Hundertsten ins Tausendste, es ist herrlich ihm dabei zuzuhören. Er referiert über die Geschichte des Schlosses und der Staatskanzlei, vor der wir just stehen, „so etwas wissen die Leute ja heute nicht mehr und das schlimmste: Sie wollen es nicht wissen! Kein Interesse, Hauptsache an den Strand und Flatrate-Saufen!“ Überhaupt: Pauschaltourismus. Kann er nichts mit anfangen und findet es furchtbar, wie sich heute alle davon betäuben ließen. Der Spitzbube wird zum Rumpelstilzchen. Und mit nur einem Satz – „dabei kann man doch so viele schöne Dinge machen!“ – ist sein plötzlicher Groll vergessen und er grinst wieder, während er seine Vita weiter vor mir ausbreitet. Uhrmacher ist er, noch immer, aber er lebt neun Monate im Jahr in Bulgarien, wo er eine kleine Pension besitzt. Ich solle mal vorbei kommen, mich eingeladen fühlen. Man könne auch dorthin fliegen, sicherlich, aber am Flughafen gehen sie ihm zu oft an die Wäsche, wenn ich verstehe, was er meint. Und deshalb nimmt er den Bus, da kennt er den Fahrer, dem gibt er immer ein bisschen etwas extra und dann kann er mitnehmen was er will, wenn ich verstehe, was er meint. Jaja, naja. Wo ich hin möchte, fragt er mich und was ich denn genau vorhabe, und ist damit meine erste Begegnung die von sich aus nicht bloß reine Verwunderung sondern zusätzlich Interesse zeigt. Und ich kann nun einige der Sätze sagen, die ich mir zuvor für diese Frage zur Hand gelegt habe: Man müsse sich das eigene Land ja mal ansehen, da passiert ja gerade so viel. Die Menschen machen sich Sorgen und da muss man doch mal sehen, warum. Ich sage, dass ich dieses Land sehr mag, dass ich solche Gedanken wie Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie und vor allem Presse- und Meinungsfreiheit zu den höchsten Werten zähle. Außerdem muss es ja nicht immer Australien oder Patagonien sein, wohin man verreist. Er nickt begeistert und möchte mir seine Adresse aufschreiben, wofür er einen NPD-Notizblock hervorkramt. Ich denke: Oha. Dann zückt er einen SPD-Kugelschreiber und ich denke: Da haushaltet jemand aber bunt mit seinen Werbegeschenken. Er notiert mir seine Anschrift, ich ihm meine Nummer und zum Abschied salutiert er mir noch einmal. Er sagt, es seien noch gut vier Kilometer bis zum Campingplatz (es sind zehn) und empfiehlt mir ein kleines Gasthaus auf dem Weg, das ich zwar kurze Zeit später sehe, aber nicht betrete, da sich im Biergarten die ersten drei offensiv ihre rechte Gesinnung zur Schau tragenden Nazis eingefunden haben, um den Freitagmittag zu verpicheln.
Bad Kleinen, wo ich eine halbe Stunde auf dem Bahngleise sitze und meine nass geschwitzten Kleider in der Sonne trockne. Dann hält der Zug und ich fahre mit ihm die letzten Kilometer bis Schwerin, wo ich ein paar kleine Runden durch die Innenstadt drehe. Hübsch haben sie es hier, das muss ich sagen. Ich stehe in der Nähe des Schlosses und halte meine Straßenkarte in der Hand um mich ein letztes mal zu vergewissern, ob ich in die richtige Richtung gehe, als jemand neben mir stehen bleibt und mich auf wundervolle Weise anspricht: „Ja, möchte er irgendwo hin?“ Ich sage, ich wüsste es bereits – zum Campingplatz – und lasse ihn es mir dennoch erklären. Dann tritt er einen Schritt zurück und legt los: So etwas wie mich gäbe es ja heute gar nicht mehr, mit Bergstiefeln und auf infanteristische Weise unterwegs. Er salutiert und haut zackig die Hacken zusammen. Jahrgang 1936 sei er und wirkt dabei zwanzig Jahre jünger. „Ja, nie geraucht und so einen Quatsch gemacht!“ Er hat ein spitzbübisches Grinsen und kommt vom Hundertsten ins Tausendste, es ist herrlich ihm dabei zuzuhören. Er referiert über die Geschichte des Schlosses und der Staatskanzlei, vor der wir just stehen, „so etwas wissen die Leute ja heute nicht mehr und das schlimmste: Sie wollen es nicht wissen! Kein Interesse, Hauptsache an den Strand und Flatrate-Saufen!“ Überhaupt: Pauschaltourismus. Kann er nichts mit anfangen und findet es furchtbar, wie sich heute alle davon betäuben ließen. Der Spitzbube wird zum Rumpelstilzchen. Und mit nur einem Satz – „dabei kann man doch so viele schöne Dinge machen!“ – ist sein plötzlicher Groll vergessen und er grinst wieder, während er seine Vita weiter vor mir ausbreitet. Uhrmacher ist er, noch immer, aber er lebt neun Monate im Jahr in Bulgarien, wo er eine kleine Pension besitzt. Ich solle mal vorbei kommen, mich eingeladen fühlen. Man könne auch dorthin fliegen, sicherlich, aber am Flughafen gehen sie ihm zu oft an die Wäsche, wenn ich verstehe, was er meint. Und deshalb nimmt er den Bus, da kennt er den Fahrer, dem gibt er immer ein bisschen etwas extra und dann kann er mitnehmen was er will, wenn ich verstehe, was er meint. Jaja, naja. Wo ich hin möchte, fragt er mich und was ich denn genau vorhabe, und ist damit meine erste Begegnung die von sich aus nicht bloß reine Verwunderung sondern zusätzlich Interesse zeigt. Und ich kann nun einige der Sätze sagen, die ich mir zuvor für diese Frage zur Hand gelegt habe: Man müsse sich das eigene Land ja mal ansehen, da passiert ja gerade so viel. Die Menschen machen sich Sorgen und da muss man doch mal sehen, warum. Ich sage, dass ich dieses Land sehr mag, dass ich solche Gedanken wie Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie und vor allem Presse- und Meinungsfreiheit zu den höchsten Werten zähle. Außerdem muss es ja nicht immer Australien oder Patagonien sein, wohin man verreist. Er nickt begeistert und möchte mir seine Adresse aufschreiben, wofür er einen NPD-Notizblock hervorkramt. Ich denke: Oha. Dann zückt er einen SPD-Kugelschreiber und ich denke: Da haushaltet jemand aber bunt mit seinen Werbegeschenken. Er notiert mir seine Anschrift, ich ihm meine Nummer und zum Abschied salutiert er mir noch einmal. Er sagt, es seien noch gut vier Kilometer bis zum Campingplatz (es sind zehn) und empfiehlt mir ein kleines Gasthaus auf dem Weg, das ich zwar kurze Zeit später sehe, aber nicht betrete, da sich im Biergarten die ersten drei offensiv ihre rechte Gesinnung zur Schau tragenden Nazis eingefunden haben, um den Freitagmittag zu verpicheln.
Auf dem Weg zum Campingplatz um den Schweriner See herum ist dann kaum ein Mensch zu sehen. Der See ist phantastisch, kleine, schattige Oasen erstrecken sich über mehrere Kilometer an seinen Ufern, wundervolle Plätze um Seelen baumeln zu lassen. Allein: Niemand nutzt sie. Wohlgemerkt: Es ist Freitagnachmittag und die Sonne scheint an einem der ersten warmen Tage des Jahres. Hier und dort überholt mich eine Fahrradfahrerin oder ein Jogger kommt mir entgegen. Niemand naherholt sich hier und ich frage mich, warum.
Als ich denke angekommen zu sein – auf meiner Faltkarten ist die Breite meines kleinen Fingers entsprechend drei Kilometern Luftlinie – höre ich von vier bis fünf weiteren Wegkilometern. Dazu mehrfach Andeutungen wie „Da gibt es doch keinen Campingplatz!“ oder die abgemilderte Version „Der hat auf jeden Fall noch geschlossen!“ Ich bin kurz davor in ein Hotel einzuchecken, gehe aber noch diesen einen finalen Abzweig in einen Wald hinein und werde nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Ja, der Campingplatz ist da. Ja, er hat noch geöffnet. Mit breitem Grinsen werde ich begrüßt, mir wird kumpelig auf die Schulter geklopft, man ist sofort per Du. Klar, wenn ich möchte warten sie in der Gastronomie noch eine Stunde mit dem Feierabend. Ich baue stöhnend und humpelnd mein Zelt auf und gehe hinüber zur Gaststädte der Süduferperle.
Das Schönste am Wandern sei das Einkehren, habe ich vor der Reise oft gehört oder gelesen. Nach diesen ersten paar Tagen ist das schönste am Wandern für mich, zu sehen wie die Welt im gleichmäßigen Schritt an mir vorüberzieht, wie sich die Landschaft langsam aber stetig verändert und ich versuche, konstant in Bewegung bleiben. Allerdings war ich in diesen Tagen noch kein mal so konzentriert glücklich und geschlaucht, zufrieden und kaputt wie in dem Moment, als mir die Wirtin mein Bauernfrühstück und ein Pils serviert. Oft braucht es nicht viel zur Selbstlegitimation; eine handvoll Eindrücke, ein paar Begegnungen, einige Kilometer mit etwas zu viel Gepäck. Man darf sich mich am Ufer des Schweriner Sees als glücklichen Menschen vorstellen.
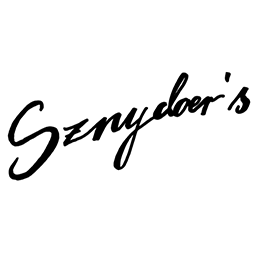



Leave a Reply