TROPICAL ISLANDS – LÜBBEN – LÜBBENAU – COTTBUS
–
In der Nacht dann endlich: Regen.
Nach vierzehn Tagen unterwegs im norddeutschen April und bisher sechs Tropfen Nieselregen, habe ich mich schon etwas gewundert. Es war eine Frage der Zeit, wann sich dies ändern würde. Nun prasseln tropisch dicke Tropfen vor Tropical Islands auf mein kleines Zelt nieder. Ich liege in der Nacht mehrfach wach und habe schlaftrunken geprüft, ob der Zeltinhalt auch trocken bleiben würde. Er würde, allerdings nur dort, wo ich nicht die Wände berühre. Ich werde also mit wenigen Bewegungen auskommen müssen, denn das Zelt ist sehr klein und ich passe neben meinem Rucksack gerade und genau so auf die Isomatte. Bewegungslos liege ich so da, hauteng eingewickelt in meinen Schlafsack. Es ist wundervoll! Schon als Kind habe ich das Geräusch von Regen auf Zeltplanen und Campingwagendächern geliebt. Hier versöhnt es mich nun vollends mit dem „Draußen“ – „Natur“ kann man dies alles ja nur schwerlich nennen. Und „Outdoor“ klingt irgendwie mehr nach Island, Neuseeland, Karpaten. Weniger nach Brandenburg, Tropical Islands, Ostdeutschland.
Mein erster Weg führt mich erneut zur Rezeption, die gleichzeitig ein Frühstückscafé ist und sich in einem ausrangierten Hangar befindet. Ich habe die Wahl zwischen einem kleinen und einem mittleren Frühstück, der Kaffee zum selber zapfen kostet 2,20€. Sektfrühstücklaune suche ich hier vergeblich. Weil ich die einzigen Gäste, ein Paar im Oberdeck nicht bei ihrem Frühstück stören möchte, nehme ich unten in einer dunklen Ecke und zwischen drei Türmen aus Pfandkisten Platz. Es regnet in Strömen gegen das Wellblech und das fahle, graue Licht ist angemessen für die Stimmung an diesem Ort.
Mein Timing heute morgen ist ein Glücksfall: Als ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, hört der Regen auf und als ich Zelt und Gepäck zum Zusammenfalten und Einpacken in das Waschhaus getragen habe, beginnt er wieder umso heftiger.
Ein Blick in den Himmel offenbart: Es wird stundenlang regnen. Ich nehme den Shuttle-Bus zum Bahnsteig nach Brand, fahre zuvor allerdings eine Extra-Runde zur Halle und wieder zurück um nicht in der trostlosen Haltestellenhütte Unterschlupf suchen zu müssen. Im Bus sitzen ausschließlich Mitarbeiter von Tropical Islands. Ich sehe den Ballonjungen in der ersten Reihe sitzen, und auch einen Bademeister von gestern erkenne ich wieder. Es wäre nun bestes Wetter für ein tropisches Schwimmbad, wenn man drinnen etwas vom Wetter draußen erkennen würde.
–

Am Bahnsteig in Brand warte ich auf den Zug Richtung Lübben. Eingeworfene Fensterscheiben, ein verrammeltes vergammelndes Bahnhofsgebäude, oberschenkelhohes Unkraut rankt sich aus den Mauerritzen. Am Bahnsteig gegenüber sucht ein tapferer Flaschensammler im Mülleimer nach Pfandwert. Nachdem seine Suche nicht von Erfolg gekrönt wird, tritt er mehrfach cholerisch gegen die Tonne. Eine Schulklasse wartet unter dem Schutz des Bahnsteighäuschendaches die letzten zwanzig Minuten mit mir auf ihren Shuttlebus zum Schulausflugsziel. Backfische und Grünlinge, allesamt ganz aufgedreht denn sie spüren die Reizwellen des Urlaubshangars. Pubertierende in einem Schwimmbad – es muss ein großartiger Tag für sie werden.
Irgendetwas lässt mich aufgekratzt und munter durch den Regen tänzeln, mein MP3-Player definiert seinen Random-Modus heute durch das Auflegen der besten weil antreibenden Tracks. Eine der aktuellen Wetterlage nicht entsprechende Euphorie hat mich im Griff. „Dance yourself clean“ fordert James Murphy und genau danach fühlt es sich an, hier im Platzregen auf dem Bahnsteig von Brand.
Die Fahrt nach Lübben dauert sieben Minuten und ich finde es dort, im Tor zum Spreewald trotz des ersten Eindrucks bestehend aus einem in Platzregen getauchten Bahnhofsviertel in grauestem Grau, gleich irgendwie ganz schön. Durch ein innerstädtisches Naturschutzgebiet läuft man direkt Richtung Stadtzentrum. Der grüne Gürtel, der durch den Regen noch einmal etwas grüner wirkt, gehört mit Ausnahme von zwei unerschrocken dahinwatschelnden Enten ausschließlich mir. Der Wald spuckt mich hinaus auf einen Marktplatz und plötzlich stehe ich mitten in der Stadt.
Und immer wieder stelle ich mir die anmaßende Frage: Wie kann ich eine Stadt nun einschätzen und ihre Ausstrahlung bewerten, wenn ich sie lediglich einige Stunden erlebe und durchlaufe? Es ist ein zutiefst oberflächliches Unterfangen und natürlich maßlos arrogant. Jedoch: Wenn ich in kurzer Zeit zwanzig, dreißig, vierzig Orte bereise und deren Atmosphären einander gegenüberstelle, entsteht zwangsläufig Sympathie für die eine, Antipathie für die andere, Gleichgültigkeit für die nächste Stadt.
Hier in Lübben geschieht nun etwas Sonderbares. Die Stadt ist in ihrer Substanz und durch ihr Leben auf den Straßen im Sinne des Durchschnitts von ähnlicher Art, wie all die anderen kleinen Städte, die ich zuvor auf meinem Weg gekreuzt habe. Ähnlich ansehnlich zurecht gemacht und restauriert, mit der massiven Kirche im Zentrum, dem weitläufigen Marktplatz um diese herum, den familiengeführten Geschäftchen mit ihren ewig ähnelnden Auslagen und der schmucklosen, funktionalen Gestaltung jeglicher Farbträger. Typisch deutsch. Doch irgendwie fühle ich mich hier wohler, trotz durchdringendem Regen, fehlendem Licht, ausgelassener Selbstlegitimation aufgrund des nicht geleisteten Tagesmarsches.
Und es wird mir hier klar, dass es neben dem geplanten und angestrebten Tagespensum, den unabhängigen weil nie ganz berechenbaren Faktor der Tagesform gibt. So wie ich am einen Tag mit scheinbar unerklärlich getrübter Laune aufwache, so ist meine Form am nächsten eine grundlegend verschiedene; optimistisch und zuversichtlich. Gut möglich, dass Lübben so etwas positives auf mich ausstrahlt, weil heute einfach Freitag ist.
Lübben und ich, oder: Die Städte und ihre Bewohner, wir alle haben unsere Faktoren, die diese Tagesform mitbestimmen. Diese sind kausal, bedingen und beeinflussen sich gegenseitig pausenlos. Meine Laune ist selbstverständlich gefärbt durch und abhängig von der Anzahl und dem Schmerzgrat der Blasen an meinen Füßen. Von der Intensität des Drucks auf meinen Rücken. Wie läuft es sich? Wie sind die Menschen zu mir? Wird hier zurück gegrüßt, gar gelächelt? Fliegen mir die Dinge, die Orte, die Anekdoten zu oder muss man jeden Stein umdrehen, um etwas zu finden, von dem man oft noch nicht einmal weiß, was genau es sein soll?
 –
–
Was wären nun Faktoren, die die Tagesform einer Stadt mit beeinflussen? Montag oder Freitag? Regnet es oder scheinen zehn Sonnen über dem Ort? Gibt es ein Straßenfest, einen Marathon oder dergleichen? Hat der örtliche Fußballverein gewonnen oder verloren? Ist der LKW-Durchgangsverkehr heute besonders stark oder abgeschwächter als sonst? Haben die Dienstleister in den Touristen-Informationen, den Bäckereien, Supermärkten, Pensionen heute ein Lächeln auf den Lippen? Haben sie Spaß an ihrer Arbeit, mit ihren Kollegen, ihren Kunden oder sind sie in Gedanken beim letzten Streit mit dem Partner, bei der knappen Miete, der womöglich beunruhigenden Perspektive?
Die Tagesformen von Lübben und mir an diesem Freitag scheinen übereinstimmend zu sein und so legt sich mein Schlüssel in das Schloss dieses Ortes und eröffnet mir eine Herangehensweise voller guten Mutes. In meinem Blick auf Lübben vereinen sich somit Kitsch und Scheiße zu einem harmonischen Bild der ostdeutschen Provinz.
Ich bekomme ein wahnsinnig gutes Backfischbrötchen von einer lächelnden, freundlichen, sympathischen Bedienung zubereitet. Sie mag ihre Arbeit, vielleicht mag sie auch einfach diesen Tag oder sogar mich, jedenfalls bemerke ich ihre Lebensfreude und die färbt auf mich ab. Das scheint mir alles, bloß nicht der Normalfall in Deutschland zu sein, wo man sich als Gast auch gerne mal wie ein Eindringling fühlen darf.
Eine Frau geleitet mich um drei Ecken, die für sie einen Umweg bedeuten, um mir die Touristeninformation zu zeigen. Dort hat man zwar alle Hände voll zu tun, denn am nächsten Tag wird hier der Spreewaldmarathon ausgetragen, doch man hilft mir gerne bei der Zimmervermittlung.
Auf dem Weg zu meiner Pension finde ich einen kleinen Tabak- und Whiskey-Laden und habe dort eine sagenhaft gut gelaunte Unterhaltung mit der Inhaberin, die ich für ihre Ausstrahlung mit dem Kauf eines überteuerten kleinen Fläschchens schwedischen Whiskeys belohne.
–
Kuriositäten heitern mich auf: In Lübben bietet der Bankautomat von sich aus 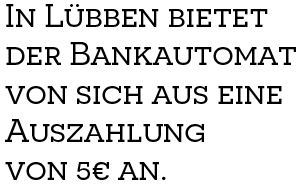 eine Auszahlung von 5€ an. Das verrät einem viel über die Kaufkraft im Ort. Ich sehe keine einzige Glatze, keinen Stiernacken, keine eindeutigen Pullover und T-Shirts, die mir mit ihrer ultrarechten, menschenverachtenden Rhetorik den Tag und mein Innenleben versauern möchten. Ich sehe stattdessen: Grüßende, ja, sogar beherzt winkende Schrebergartenbesitzer! Das ist wirklich ein Novum. Ich sehe auch eine Schule, es hat just zur Pause geläutet und die Jugendlichen bevölkern den Schulhof oder stehlen sich zum heimlichen Rauchen von diesem davon. Das macht mir Mut, denn es ist das erste mal, dass ich die Jugend beobachten kann. Zuvor bin ich an Plätzen der Jugend, Straßen der Jugend, Alleen der Jugend, Denkmälern der Jugend, Stadien der Jugend vorbeimarschiert ohne auf die Jugend selbst zu treffen. Sie muss noch hier in der Provinz anzutreffen sein, denn in der Jugend lockt es einen selten fort in die Ferne. Nur die ganz Wagemutigen ziehen mit sechzehn bereits von zu Hause aus, werden flügge, und geben sich dem Sturm und Drang hin, weil sie keine Luft bekommen in dem eng geschnürten Korsett der Provinz oder sich mit ihrer Familie zerstritten haben. Hier auf diesem Schulhof allerdings wirkt es sehr idyllisch und unaufgeregt. Es wirkt nicht, als würde hier jemand für demnächst eine Abreise planen.
eine Auszahlung von 5€ an. Das verrät einem viel über die Kaufkraft im Ort. Ich sehe keine einzige Glatze, keinen Stiernacken, keine eindeutigen Pullover und T-Shirts, die mir mit ihrer ultrarechten, menschenverachtenden Rhetorik den Tag und mein Innenleben versauern möchten. Ich sehe stattdessen: Grüßende, ja, sogar beherzt winkende Schrebergartenbesitzer! Das ist wirklich ein Novum. Ich sehe auch eine Schule, es hat just zur Pause geläutet und die Jugendlichen bevölkern den Schulhof oder stehlen sich zum heimlichen Rauchen von diesem davon. Das macht mir Mut, denn es ist das erste mal, dass ich die Jugend beobachten kann. Zuvor bin ich an Plätzen der Jugend, Straßen der Jugend, Alleen der Jugend, Denkmälern der Jugend, Stadien der Jugend vorbeimarschiert ohne auf die Jugend selbst zu treffen. Sie muss noch hier in der Provinz anzutreffen sein, denn in der Jugend lockt es einen selten fort in die Ferne. Nur die ganz Wagemutigen ziehen mit sechzehn bereits von zu Hause aus, werden flügge, und geben sich dem Sturm und Drang hin, weil sie keine Luft bekommen in dem eng geschnürten Korsett der Provinz oder sich mit ihrer Familie zerstritten haben. Hier auf diesem Schulhof allerdings wirkt es sehr idyllisch und unaufgeregt. Es wirkt nicht, als würde hier jemand für demnächst eine Abreise planen.
Die Schüler und die Schrebergärten bilden ein Spalier hinauf zu meiner etwas außerhalb des Ortskerns gelegenen Pension. Auch dort haben die Besitzer ein Lächeln auf den Lippen als sie mich sehen. Ich spaziere anschließend drei Stunden durch den Ort und suche einen Supermarkt, wobei ich systematisch jede Straße ablaufe. Dabei begegne ich Ein-Euro-Jobbern, die mir heiter die Wege erklären. In Lübben gibt es drei Fotoateliers in unmittelbarer Nähe zueinander. Ich pausiere in einem Café, in dem zwischen Bedienungen und Kunden geflirtet und geschäkert wird, dass sich die Balken biegen, über den Tresen, bei einer Raucherpause vor der Tür. Und als ich Abends zurück zu meiner Pension laufe, die Kamera in der Hand, überquere ich eine Brücke. Unten arbeiten zwei Männer an dem Ausbau eines Anlegers. Sie schauen mich an und der eine ruft mir zu: „Urlauber oder Presse?“ „Beides ein bisschen“ antworte ich ihm und er ruft zurück: „Na, dann genießen sie das mal schön als Urlauber, aber der Presse muss ich sagen: Berichten sie mal über die Brücke, die muss auf jeden Fall neu gemacht werden!“ Lübben hat an diesem Tag eine beeindruckend optimistische Tagesform aufzuweisen und mir gefällt mein hier verbrachter Tag sehr.
Ich muss in der Chronologie zwei Tage voraus greifen, um zu zeigen, wie entscheidend die Tagesform für den Eindruck eines Ortes sein kann. Cottbus, eine Stadt wie ein tragischer Autounfall.
–
 So hell und offen die Ausstrahlung von Lübben auf mich wirkte, so sehr kam sie im ebenfalls verregneten Cottbus wie eine zutiefst verbitterte Zumutung daher. Es lag hier etwas in der Luft und es waren nicht: Hoffnung, Zuversicht, Menschlichkeit. Aggressivität, Hass, Angst – man konnte es hier lesen, spüren, sehen. Jede Menge substanzloser Ansichten, Blicke, Schmierereien, die mit viel Wohlwollen als schlichte Frustration durchgehen und dabei einen Eindruck vermitteln, als sei dieser Ort nicht erst seit gestern oder heute von allen guten Geistern verlassen.
So hell und offen die Ausstrahlung von Lübben auf mich wirkte, so sehr kam sie im ebenfalls verregneten Cottbus wie eine zutiefst verbitterte Zumutung daher. Es lag hier etwas in der Luft und es waren nicht: Hoffnung, Zuversicht, Menschlichkeit. Aggressivität, Hass, Angst – man konnte es hier lesen, spüren, sehen. Jede Menge substanzloser Ansichten, Blicke, Schmierereien, die mit viel Wohlwollen als schlichte Frustration durchgehen und dabei einen Eindruck vermitteln, als sei dieser Ort nicht erst seit gestern oder heute von allen guten Geistern verlassen.
Als ich auf dem Fernwanderweg die Stadt betrete, mich durch Schrebergärten und Platzregen auf die dominanten Plattenbauten zubewege, werde ich um ein Haar vorsätzlich auf die Hörner, respektive die Motorhaube einer jungen Frau genommen. Ich überquere eine Nebenstraße in der Nähe eines Supermarktes, es sind noch gut siebzig Meter Platz zwischen dem herannahenden Auto und mir, generell ist hier eine Tempo-30-Zone, doch die Frau drückt aufs Gas und schert nach außen aus und damit auf mich zu. Ich erreiche den sicheren Bürgersteig ohne Hast und starre sie fassungslos an, als sie in einem Tobsuchtsanfall an mir vorbei rast. Sie zeigt mir den Mittelfinger und brüllt irgendetwas in den Innenraum ihres Autos hinein. Okay, du Punse! Ich schlage mit meinem neuen Wanderstock auf den Boden, brülle und spucke ihr nach, gestikuliere anhand ihrer Körpersprache, fluche hinter ihr her. Hätte sie gehalten und wäre zurück gekommen, ich hätte für nichts garantieren können, so rasend bin ich über diesen ersten Eindruck.
Und so wie mich diese Frau stellvertretend für Cottbus begrüßt, so wird es weitergehen in dieser Stadt, für die ich wenig außer Verachtung, Zorn und Ekel übrig haben werde, als ich sie einen Tag später verlasse.
Es regnet in Strömen, als ich die Innenstadt betrete. Der obligatorische erste Gang in das Informationszentrum bringt mir das Unterkunftsverzeichnis ein, welches ich am Markt durchblättern möchte. Ich setze mich vor ein Café, werde dort allerdings nicht bedient. Also gehe ich hinein und schaue in die erstaunten Gesichter aller Gäste und Angestellten. Klar, ich bin triefend nass, habe einen riesigen Rucksack auf dem Rücken und einen Wanderstock in der Hand. Ich bin mittlerweile recht zottelig im Gesicht, aber ich kann sprechen, grinsen und freundlich „hallo“ sagen, doch an den Blicken ändert sich nichts. Alles sehr schicke, junge, hippe Menschen hier, die ersten modischen Frisuren seit Berlin, alle körperbetont und lässig in einfarbige, zumeist schwarze, weiße oder graue Kleider gehüllt, stilvolle Accessoires, wenig Logos, szeniges Understatement – und ich stehe in der Tür wie ein Aussätziger. Ich bin der Obdachlosenzeitschriftverkäufer ohne Zeitungen in einem Prenzlauer Berg Café ohne Mütter. Ich bin hier ganz klar: Fehl am Platz. Auf der Stelle mache ich kehrt und suche mir im Gehen eine am Stadtrand gelegene Herberge aus der Broschüre heraus, zu der ich nun marschiere.
Auf dem Weg kommen mir dutzende Energie Cottbus Fans entgegen, sie sind auf dem Weg in das „Stadion der Freundschaft“, ein Name, der mir immer schon sympathisch war. Zutiefst unsympathisch dagegen: „Asylant go home!“, geschmiert an unzählige Brückenpfeiler, an Unterführungswände, auf geteerte Wanderwege. Es vergiftet meine Laune und lässt mir wenig Spielraum für Sympathie oder Verständnis diesem Ort gegenüber. Habe ich manchmal den Eindruck, ich könne die ganze Welt umarmen, so fühle ich mich hin und wieder, als sei alles was ich brauche, eine Fresse zum anbrüllen. In solch ein minderbemitteltes Würstchen verwandelt mich also diese Stadt.
–
 –
–
Ich erreiche die Pension komplett verregnet und während ich heiß dusche, lasse ich den Fernseher laufen. Ich sehe wie Energie noch vor dem Halbzeitpfiff das 0:3 und das 0:4 fängt. Gegen Sonnenhof-Großaspach, diesen Verein, bei dem ich immer sofort an Andrea Berg denken muss. Cottbus droht der Abstieg und damit der Abschied aus dem professionellen Fußball, was für die Atmosphäre hier und heute in den Straßen dieser Stadt nichts Gutes bedeuten kann. Und so werde ich einige Fans in den nächsten Stunden sehen, die ihren Frust im Dosenbier ertränken und mit denen ich weder über Fußball noch über Asylanten oder Europa diskutieren möchte. Atmosphäre allenthalben: AfD-Graffitis, ausländerfeindliche Sprüche, schiefe Blicke, schneidend von der Seite zu mir hinüber geschleudert, während ich eine Banane essend vor einem Supermarkt stehe und die deprimierten Fans bei der Heimkehr beobachte. Ich halte den Blicken stand und fühle mich dabei wie in diesen Bruchteilen einer Sekunde, wenn man sieht, dass ein Ball auf das eigene Gesicht zurast oder man einen Sturz nicht mehr abwenden kann. Der Aufprall bleibt aber hier und heute aus.
Das Erscheinungsbild der Stadt Cottbus lässt wenig Raum und Grund für Diplomatie zu und besteht lediglich aus der „guten Stube“ um den entzückend restaurierten Marktplatz und ganz, ganz viel Tristesse, Frustration, Enttäuschung und Platte um diesen herum. Passanten tragen Eistüten, Kinder, Einkäufe und Smartphones durch die aufgeräumte Fußgängerzone. Die Pücklerallee, der Park, die Pyramiden – das alles ist äußerst pittoresk und anmutig. Doch ich bin hier vollends allein. Keine Menschenseele zieht Kraft, Ruhe, Ausgeglichenheit aus der Wirkung des nahenden Frühlings in der Parkanlage. Man möchte sie alle abholen aus ihrem Stadion der Freundschaft und ihrer Fußgängerzone und in diesen Park schieben. Und während ich so miesepetrig in mich hinein schimpfe, bleibt ein letzter Funken Hoffnung, dass es lediglich die Tagesform war, die Energie hat untergehen lassen und aus diesem womöglich einfach mittelmäßigen Ort eine Gemütskloake voller Welt- und Menschenschmerz gemacht hat.
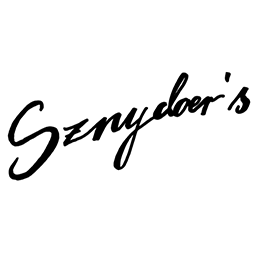



Leave a Reply