HEIDENAU – DRESDEN
–

Heidenau.
Natürlich muss ich mir dich ansehen.
Der Bahnhof bröselt vor sich hin. Direkt davor findet sich ein riesiger Schriftzug, an Hohn, Sarkasmus und Zynismus kaum zu überbieten. „MITEINANDER“ steht dort in eineinhalb Meter großen Lettern. Als ich ihn fotografiere, schneidet mich ein Auto auf ziemlich rabiate und durchaus bewusste Art. Zeichensprache hier: Mein Leben, meine Gesundheit zumindest, ist ein enges Höschen an diesem Ort.
–
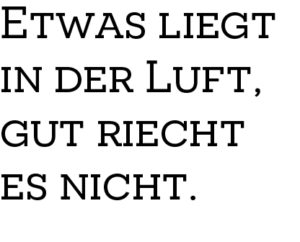 Den Stock fest und womöglich bereits leicht paranoid umschlungen, trotte ich ungläubig durch diesen Ort, vanillegelb und grau und mit einigen zerschlagenen Scheiben breitet er sich vor mir aus. Keine Bäckerei ist zu finden, bis ich vor dem verhältnismäßig geschäftigen Einkaufszentrum stehe, ein großer Supermarkt mit integrierter Bäckerei, Drogeriemarkt, Kleiderladen. Die Sitzecke des Kaffees ist ein einziger toter Winkel, dunkel, glatt, fensterlos – ich halte es hier nicht aus. Wieder hinaus, es muss doch noch mehr hier geben. Oder? Mehrere Vietnamesische Restaurants, ich erstarre vor dem Mut oder dem Leichtsinn der Besitzer. 2Cl Whiskey kosten hier 1,30€. Wenn man sich mitunter fragen mag, warum es für manche Menschen nicht besorgt genug sein kann, dem empfehle ich einen Besuch hier vor Ort. Etwas liegt in der Luft, gut riecht es nicht. Ich muss schnell zurück zum Bahnhof, schnell weg von hier, ich habe genug gesehen.
Den Stock fest und womöglich bereits leicht paranoid umschlungen, trotte ich ungläubig durch diesen Ort, vanillegelb und grau und mit einigen zerschlagenen Scheiben breitet er sich vor mir aus. Keine Bäckerei ist zu finden, bis ich vor dem verhältnismäßig geschäftigen Einkaufszentrum stehe, ein großer Supermarkt mit integrierter Bäckerei, Drogeriemarkt, Kleiderladen. Die Sitzecke des Kaffees ist ein einziger toter Winkel, dunkel, glatt, fensterlos – ich halte es hier nicht aus. Wieder hinaus, es muss doch noch mehr hier geben. Oder? Mehrere Vietnamesische Restaurants, ich erstarre vor dem Mut oder dem Leichtsinn der Besitzer. 2Cl Whiskey kosten hier 1,30€. Wenn man sich mitunter fragen mag, warum es für manche Menschen nicht besorgt genug sein kann, dem empfehle ich einen Besuch hier vor Ort. Etwas liegt in der Luft, gut riecht es nicht. Ich muss schnell zurück zum Bahnhof, schnell weg von hier, ich habe genug gesehen.
–
–
Im Zug dann ein Mädchen, um die zwanzig Jahre alt. Sie schaut so, wie man an den frühen Morgen zu Beginn eines Studiums schaut. Die Welt kann sie mal gerne haben, kreuzweise wenn es recht ist. So steht sie da und schaut aus ihren schwarzen Klamotten heraus, ihre harte, kompromisslose Ausstrahlung beeindruckt mich. Ich frage mich, ob ich sie am Abend bei der Gegendemonstration wiedersehen werde, denn ihr Blick sieht nach dem Schwarzen Block aus, ihre Attitüde lässt Wut erahnen. Ob diese politisch motiviert ist oder einfach nur am Fakt des Montags liegt, kann ich schwer sagen. Sie ist mir sehr sympathisch mit ihrem zierlichen Körper, den markanten Wangenknochen und den harten Augen, dem Nasenpiercing und den Dockarbeiterstiefeln – wie eine verschlafene, linke Jeanne D’Arc steht sie da und schaut aus dem Fenster der S-Bahn. Sie wirkt wie der Beweis dafür, dass eine Strömung immer auch eine Gegenströmung erzeugt, Gewalt Gegengewalt bedingt. Beim Aussteigen nicke ich ihr zu, womit sie nicht gerechnet hat, denn sie schaut als sei sie plötzlich geweckt worden. Montags in Dresden scheint es keine Selbstverständlichkeiten zu geben.
Ausstieg am Hauptbahnhof – hier steigt also heute die Horrorshow. In Dresden herrscht ein anderer Schnack, das bemerke ich zeitig. Eine Bäckerin hasst mich, sie hasst vermutlich auch ihr Leben. Die Polizisten mustern mich lange und mit hartem Blick, lassen mich aber unkontrolliert weiterziehen. So geht es weiter bis hinauf in die Neustadt, wo die Bedienung in meinem Hostel ein wahrer Engel ist. Mir genügt schon, dass sie grinsen kann, dass sie nicht verbittert auf diese Stadt und auf mich schaut. Sie ist gekleidet in der Symbolik der Neustadt, rot gefärbte Haare, Nasenpiercing, Tattoos und eine offene, einladende Ausstrahlung.
Wandeln in der Stadt. In der Neustadt fühle ich mich wohl. Man kann hier einfach vor sich hin sein ohne anzuecken, zu liberal ist es hier, um wirklich aufzufallen. In der Altstadt hingegen bin ich der Exot. Ich wollte unbedingt wieder Menschen um mich herum und hier habe ich sie. Touristengruppen, Fremdenführer, Hobbyfotografen. Mit kurzer Hose, roter Mütze, Bergstiefeln und Wanderstock bin ich zwischen ihnen eine ziemlich markante Gestalt. Derart exponiert betrete ich den Platz vor der Frauenkirche und werde von einer Nebelkrähe empfangen. Als ich sie ansehe, wie sie auf einer Laterne über dem Platz thront, kräht sie dreimal laut auf. Ich grinse sehr verbunden, gehe einige Schritte weiter, bleibe dann stehen, blicke zu ihr hinauf und sie kräht erneut dreimal. Noch einmal wiederholen wir dies und ich fühle mich, als sei ich nicht mehr alleine in dieser Stadt. Sehr albern erscheint mir dies zwar, aber es ist auch sehr hilfreich. Danke, mein Freund, ob du mich nun meinst oder nicht.
Mit Blick auf die Frauenkirche speise ich. Die Frauenkirche – restaurierte Solidarität, leider gleichzeitig ein Indiz dafür, wie unsympathisch mir diese Stadt sein kann. Ein sakraler Bau im heidnischen Osten, als Steinhaufen ehedem ein Mahnmal gegen Krieg, dann vor allem durch Spenden – aus Polen, aus England, von Hinterbliebenen damaliger Widerstandskämpfer – wieder aufgebaut. Mit Geld aus der ganzen Welt! Eine Kirche! Das finden sie sehr schön und vorbildlich, die Dresdner, die Touristen, die Wiederaufbauer. Und in den Ortschaften im hiesigen Speckgürtel fliegen Brandsätze auf alles andere als prunkvolle Funktionsbauten, in denen Geflüchtete und Zersprengte notdürftig untergebracht werden. Die Absurdität in der unterschiedlichen Definition von Solidarität manifestiert sich in Dresden durch eine Kirche.
Mir läuft eine Nonne über den Weg – sie schenkt mir das wärmste Grinsen, das ich bisher erleben durfte. Sie sieht meinen Stock, meine blanken Waden, die mittlerweile nach einigen Kilometern aussehen, und schaut mir so tief und verständnisvoll in die Augen, dass ich sie am liebsten drücken möchte. Nonnen und Flüchtlinge, es bleiben die empathischen Begegnungen.
Ich werde nervöser. „Mordor“ – so haben einige Freunde von mir Sachsen genannt, „A Hobbit’s Tale“, das war mein Marsch für sie. Der kleine Mann mit großem Gepäck unterwegs durch ein düsteres Land. Hier in Dresden fühlt es sich dann tatsächlich an, als stehe ich vor dem Schicksalsberg meiner Reise.
Auf dem Weg in Richtung Bahnhof sehe ich erste prächtig gelaunte Gruppierungen Deutschlandfahnen schwenkender Passanten. Dann bemerke ich die Putinisten am Straßenrand. Auf einem miserabel gesetzten Plakat fordern sie Barack Obama auf, seinen Nobelpreis an Wladimir Putin abzugeben. Sie macht mir zunehmend Angst, diese Stadt. Wer in den Dingen zuerst das Gute sieht, kann in Dresden folgendermaßen ansetzen: Hier kann man über sämtliche Schmerzgrenzen hinaus lernen, tolerant zu sein.
Ich habe noch etwas Zeit und betrete ein günstig gelegenes Fast Food Restaurant. Die Bedienung am Kaffeestand ist heillos überfordert. Ich sehe einen jungen Mann, der vor der Kasse herumstreunert und irgend etwas im Schilde zu führen scheint. Er greift sich eine Packung Kekse und läuft mit dieser durch das Restaurant. Es muss eine Art Testlauf sein. Niemand reagiert. Er bemerkt, dass ich ihn bemerke. Schließlich bin ich an der Reihe und bestelle meinen Kaffee. Als mir die Bedienung den Rücken zuwendet, beugt sich der Zwielichtige über den Tresen und greift an mir vorbei. Seine Augen sind direkt neben meinen und er starrt mich an, während er zwei Packungen Schokolade einsteckt. Blitzschnell wendet er sich wieder ab. Was soll ich tun? Er schaut aus wie ein Fleisch gewordenes Klappmesser auf zwei Beinen. Ich mache also: Nichts. Mein Kaffee ist fertig und ich bin auf dem Weg in die obere Etage, als er sich neben zwei ältere Damen setzt. Das Restaurant ist im besten Falle zur Hälfte gefüllt und sie lassen ihn direkt neben sich sitzen, beinahe auf ihrem Schoß, sehr unbesorgt. Vorbildlich, eigentlich. Ich sollte vielleicht eingreifen.
Stattdessen nehme ich oben Platz und schaue durch die Glasfront nach unten auf Dresdens Urbanität: Polizei, jugendliche Punks, geschwenkte Deutschlandfahnen, Sachsenfahnen, folkloristische Mitbringsel, nationalen Tinnef wie er vorfreudigst in Richtung Hauptbahnhof getragen wird.
Plötzlich kommt der vermeintliche Dieb von eben hinauf, trägt ein voll beladenes Tablett in die Ecke der oberen Etage und setzt sich an einen Tisch mit zwei pubertierenden Jungs. Ich schäme mich, denke, dass ich ihn zu unrecht verdächtigt habe, unangenehme Vermutungen und Vorurteile. Sicher hat er die Schokolade und die Kekse noch bezahlt und dann Essen für seine kleinen Brüder gekauft. Nun allerdings kommen zwei Frauen hinauf, ihre Blicke durchsuchen die Etage und erfassen ihn hinten in der Ecke sitzend. Eine Minute später kehren sie mit einer Angestellten des Schnellrestaurants zurück und bauen sich vor dem Erwischten auf. Schnell wird klar: Er hat ihre Bestellung mitgenommen. Er sagt, er „dachte es sei frei“ und die Angestellte, nun sichtlich erbost und weitaus mutiger als beispielsweise ich einige Minuten zuvor, sagt ihm wie dreist dies sei, dass man fragt bevor man etwas nimmt, und dass er umgehend das Restaurant verlassen soll. Er tut wie ihm geheißen, schaut mir tief in die Augen als er an meinem Tisch vorbei geht und beginnt draußen direkt vor der Tür die mitgenommenen Cookies zu verdrücken. Mit prallgefüllter Umhängetasche macht er sich auf den Weg in Richtung Bahnhof und ich frage mich, was wohl die beiden Jungs denken müssen, die etwas verunsichert an ihrem Ecktisch sitzen.
Es wird Zeit – ich breche auf.
Ich zittere, vor Kälte, vor Ekel, weil mir Angst und Bange wird, weil meine innere Unruhe ausbrechen und ich schreien möchte und dies aber nicht darf oder zumindest hier und jetzt nicht tun sollte. Warum eigentlich nicht? Weil es undemokratisch wäre, eine angemeldete Demonstration zu stören? Weil ich hier mit einem Presseausweis unterwegs bin und dieser eine grundlegende Objektivität und Neutralität voraussetzt? Weil man sich nicht mit einer Sache gemein macht, sei sie auch noch so ehrenhaft, richtig und gut? Hanns-Joachim Friedrichs Motto, es liegt mir generell sehr am Herzen. Doch wie um alles in der Welt soll das hier möglich sein? Wie kann man Montagsabends in Dresden neutral bleiben, wenn ein Herz in einem schlägt?
Viele sitzen noch vor einer benachbarten Fleischerei, essen Würste, trinken Bier und richten ihre Deutschlandkäppchen, zeigen sich neueste Posts auf der Facebookseite von PEGIDA. Doch der Bahnhofsvorplatz füllt sich langsam. Die zuhauf angeschleppten Flaggen verbinden sich langsam zu einem abstrakten Potpourri: Deutschland – richtig und falsch herum gehisst – und Sachsen natürlich, dazu die Wirmer-Flagge die sie hier für sich vereinnahmen, Schwarz-Weiß-Rote und selbstverständlich die PEACE-Flaggen, denn Frieden und Ruhe scheint den Menschen hier eine Herzensangelegenheit zu sein. Russlandfahnen sowieso, dazu Israel, die DDR, Flaggen auf denen ein Ritter zu Pferd Menschenumrisse mit Sprengstoffgürteln verfolgt, dazu der Spruch „Islamists not Welcome“, Flaggen auf denen Hakenkreuz und Antifa-Symbol in einen Mülleimer geworfen werden, Flaggen mit Totenköpfen. Dazu gesellen sich Transparente mit Botschaften gegen Merkel, Merkel als Hitler, Merkel als Mutti-Multikulti mit Kopftuch, man ist um kaum einen Vergleich verlegen. Das Compact-Magazin wird freudigst beworben. Ein junger Mann trägt ein Transparent, auf dem sich „Gegen Nazis“ lesen lässt – auch von all den bulligen Ordnungskräften die ziemlich klar und deutlich nicht gegen Nazis sind. Selbst gebastelte Plakate und Transparente mit wütenden Botschaften über Volksverräter, die da oben, wir hier unten, „wir das Volk“, ihr der „Politikerabschaum“, „Lügenmedien“, „Lügenpresse“, dazu Ortsschilder und weiße Tauben. „Stop! Asybetrüger – Jeder ist einer zu viel! Go Home! Not welcome! Abschieben!“ liest man in kindlicher, disproportionierter Krakelschrift. Tonnenweise Hass auf einem Bahnhofsvorplatz, ein Sammelsurium an substanzlosen Ansichten. Mir wird anders.
–

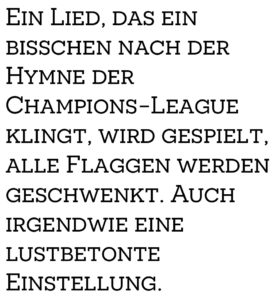 Botho Strauß schreibt: „Das wirkliche Elend besteht darin, dass sich das wirkliche Elend nicht Luft machen kann. Es erniedrigt das Bewusstsein, es sprengt nicht. Das große Leiden hockt in den tausend nichtssagenden Leidern.“ Allein: Hier machen sich Leute gehörig Luft, schlechte und müffelnde Luft gewiss, doch leidend ist hier vor allem der Betrachter.
Botho Strauß schreibt: „Das wirkliche Elend besteht darin, dass sich das wirkliche Elend nicht Luft machen kann. Es erniedrigt das Bewusstsein, es sprengt nicht. Das große Leiden hockt in den tausend nichtssagenden Leidern.“ Allein: Hier machen sich Leute gehörig Luft, schlechte und müffelnde Luft gewiss, doch leidend ist hier vor allem der Betrachter.
Das Mikrofon wird getestet. Lutz Bachmann nutzt die günstige Gelegenheit um sich etwas zotig auf seine Rede einzustimmen. „Es ist ein Handy abgegeben worden. Falls jemand ein Handy vermisst, soll er sich an der Bühne melden.“ Dann, zwei Minuten später: „Bei dem abgegebenen Handy ist die ungarische Sprache eingestellt, das dürfte den Kreis der potentiell suchenden etwas verringern. Oder es ist einer Fachkraft aus der Hand gefallen.“ Hämisches Lachen auf dem gesamten Platz, zumindest bei denjenigen, die seine Andeutung verstehen können. Das sind beim besten Willen nicht mehr alle, denn hier wird gesoffen als gäbe es kein Morgen mehr im Abendland. Auf dem Bahnhofsvorplatz und während der Demo an sich herrscht Alkoholverbot, die Testosteronclique in Ordnerwesten sorgt penibel dafür, dass dies so bleibt. Clever allerdings: Zwei Meter abseits der Demonstration ist das Alkoholverbot natürlich nicht mehr bestehend und deshalb treten immer wieder kleine Grüppchen aus der Menge heraus, kippen sich hastig eins, zwei, drei, vier Kräuterschnäpse hinunter und verschwinden wieder im Getümmel. Wurst, Hetze, Kräuterschnaps und gute Laune. So ist das hier.
–
Der Platz füllt sich immer weiter, mittelgroße Grüppchen treten aus dem Hauptbahnhof heraus und gesellen sich zu dieser Volksfestatmosphäre. Sie schwenken ihre Ortsschilder und somit weiß man um ihren logistischen Aufwand: Teilweise haben sie eine oder zwei Stunden Fahrt auf sich genommen um an einem Montagspätnachmittag hier mitzulaufen. Man muss sich frei nehmen für so etwas oder aber arbeitslos sein.
Menschen mit militärisch zackiger Körpersprache und paramilitärisch kombinierter Kleidung verteilen Flyer. Ich nehme sie alle mit, kenne Deinen Feind. „RECHT ZUM WIDERSTAND“ steht auf ihnen, „WARNUNG: UNTER MITHILFE UNSERER POLITIKER WIRD UNSER VOLK AUSGETAUSCHT!“ Von der angeschleppten Krätze ist die Rede und von der steigenden Kriminalität durch Migranten, die Deutschland in eine „No-Go-Area“ verwandelt. Es heißt, linker Terror bedrohe den Staat und seine Bürger, und dass ein Konglomerat an Politikern, die eigentlich Diktatoren sind, dafür sorge, uns dumm und unten zu halten, indem wir über gleichgeschaltete Massenmedien mit einlullenden Durchhalteparolen, Lug, Trug und Schönfärberei betäubt werden. Alles hier ist gestern.
„Jetzt geht’s los! Jetzt geht’s los!“ – Gegröle. Lynchstimmung. Ein Lied, das ein bisschen nach der Hymne der Champions-League klingt, wird gespielt, alle Flaggen werden geschwenkt. Auch irgendwie eine lustbetonte Einstellung. Thomas Wolfe beschreibt mit Blick auf die deutsche Angst eine „seelischen Fäulnis“ von der ich glaube, dass man sie hier ziemlich penetrant riechen kann.
Auftritt eines vollkommen realitätsgestörten Lutz Bachmann. Die Österreicher werden als Vorbild gepriesen, einen Tag zuvor ist dort eine Flüchtlingsobergrenze von 37.500 eingeführt worden. Keine noch so hanebüchene Gelegenheitsgelegenheit wird ausgelassen, die Presse- und Medienlandschaft zu beschimpfen. Bachmann lobt sein Verhalten während des Prozessauftakts gegen ihn, bei dem er sich als Opfer einer Kampagne sieht. Bachmann als LGBT-Heroe; man solle mal versuchen als homosexuelles Pärchen händchenhaltend durch Saudi-Arabien zu gehen. Angela Merkel nennt er bloß Üngülü Mürkül. Ein wegen Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Drogenhandel verurteilter sehr wütende Mann urteilt hier über das kriminelle Potential von Flüchtlingen, Politikern und Medien und die Menschen lieben ihn dafür. In was für einem menschenverachtenden Dada-Stück bin ich hier gelandet?
Die Menschen um mich herum: Schwarz-Rot-Goldene Fanartikel an angespannten Handgelenken, um die zornrote Stirn, auf den sorgengefalteten Köpfen, um die üppigen Leiber. Tucholsky kommt mir in den Sinn: Sie „lassen eisige Masken über das gleiten, was sie als ihr Gesicht ausgeben.“
–

Nein, ihr seid nicht die Mitte, ihr seid die von allem – von der Intelligenz, der Toleranz, der Empathie, meinetwegen auch von Gott – verlassene Randgruppe, die bei 80 Millionen Menschen nicht zu verhindern ist. Oder?
Und dann sehe ich sie direkt vor mir stehen: Meindl-Wanderstiefel, Levis 501, Lammfellmantel, Burberry-Schal, stilvolles Stirnband, Brilli-Ohrringe. Ihr etwas beschränkt dreinschauender Mann („was bedeutet denn eigentlich ‘pessimistisch’?“) mag ihre Erscheinung etwas abwerten, aber wie sie hier vor mir steht – stilsicher, selbstzufrieden und -bewusst, mit einem intelligenten Funkeln in den Augen – lässt sie mich erschaudern und ungläubig ihre Gestik betrachten. Wie sie ihre Augen genüsslich in der Sonne schließt und Bachmanns Parolen und Pointen hinterher jubelt, „Yeah!“, „Jaaaa!“ Sie kreischt hier einen Mann zu, der seinem Sohn ein Jahr keinen Unterhalt zahlt. Ein Mann der sich nach Südafrika absetzt, als ihm das Gefängnis droht. Ein Mann der aus seiner Verehrung für den KuKluxKlan keinen Hehl macht. Das alles möchte ich dieser Frau in ihr hübsch gezeichnetes und selbstzufriedenes Gesicht schreien, schütteln möchte ich sie.
Bachmann ist inzwischen bei der SPD angekommen, ein dankbares Thema. Die Frau vor mir öffnet ihre Augen noch immer nicht, sie hat ihr Gesicht gen Sonne geneigt, als sie leidenschaftlich „Ausrotten!“ und „Ausmerzen!“ schreit, „Jawolllll!“ Es geht hier um eine traditionsreiche und krisengeplagte Partei, nicht um einen Virus oder einen Kinderpornoring. Diese Dame ist in ihrer Körpersprache und Eleganz, in der weichen Tonart ihrer Stimme – wenn sie einmal nicht vom Ausmerzen spricht – jemand der wirkt, als habe man sie gerne in irgendeiner Funktion um sich. Als Lehrerin vielleicht oder Steuerberaterin, Pilotin oder womöglich Ärztin. Doch sobald sie mit einstimmt in diesen schiefen Chor und Bachmanns menschenverachtendes Geschwafel anfeuert, dann wird sie zum Nichtmenschen. Zu einer verabscheuungswürdigen Kreatur ohne nachvollziehbare Denkmuster. Irgendetwas kocht in ihr und es hat nichts mit Liebe, Achtsamkeit, Respekt oder Empathie zu tun.
Ekel färbt mich blass, es wird: Zu viel. Ich würde hier sehr gerne explodieren, provozieren indem ich etwas geschmackloses rufe, Lutz Bachmann oder die Mütter aller Anwesenden beleidigen beispielsweise. Kraft fehlt mir oder Mut, wahrscheinlich aber beides. Ich stehle mich davon. Letzte Worte: Hämisches Lachen von einigen euphorisch Besorgten, die mich mit meinem Stock sehen, meinen Bart und meine rote Mütze mustern und nun ihre fad-flachen Witzchen reißen. Der Körper reagiert tatsächlich: Kreidebleich und zitternd passiere ich die Polizisten, die noch immer Bier saufenden Schwachköpfe beim Fleischer, die Außenstehenden und Zaungäste dieses Randgruppenauflaufs. Ich suche die Gegendemonstration, sie muss hier irgendwo sein! Die Hanswurst-Veranstaltung hat einen Marsch durch die Einkaufsstraße und Fußgängerzone angekündigt. Dresden, lass’ mich bitte nicht vollends im Stich!
–
 Und dann finde ich sie: Etwa einhundert Gegendemonstranten haben sich versammelt. Es sind geschätzt neunzig Jungs und Mädchen vom sogenannten „Schwarzen Block“, darunter wunderschöne junge Frauen mit Nasenpiercings und einer freigeistigen Ausstrahlung, bunte Reggae-Rentner, Karten spielende Punks, Sitzkreise Kapuzenpullover tragender junger Männer mit Dosenbier, und einige etwas bunter gekleidete Fahrradfahrer. Sie werden eingerahmt von zahlreichen Polizisten, es sind tatsächlich deutlich mehr Beamte hier vor Ort, als am Hauptbahnhof zu sehen waren.
Und dann finde ich sie: Etwa einhundert Gegendemonstranten haben sich versammelt. Es sind geschätzt neunzig Jungs und Mädchen vom sogenannten „Schwarzen Block“, darunter wunderschöne junge Frauen mit Nasenpiercings und einer freigeistigen Ausstrahlung, bunte Reggae-Rentner, Karten spielende Punks, Sitzkreise Kapuzenpullover tragender junger Männer mit Dosenbier, und einige etwas bunter gekleidete Fahrradfahrer. Sie werden eingerahmt von zahlreichen Polizisten, es sind tatsächlich deutlich mehr Beamte hier vor Ort, als am Hauptbahnhof zu sehen waren.
Ich beginne das Gespräch mit einem sehr freundlich aussehenden Herren, er trägt einen Button an seinem Fischgrätenmantel, darauf ist ein Herz zu sehen und der Spruch „Herz statt Hetze“. „Entschuldigung, sind sie von hier? Darf ich sie fragen wie man das aushält ohne verrückt zu werden?“ Die Region Dresden gilt als Hochburg von PEGIDA, in ihrer Peripherie finden die aggressivsten Anschläge und Übergriffe auf Flüchtlinge und Unterkünfte statt, hier sind die größten Demonstrationen mit den kleinsten Gegendemonstrationen. Es folgt ein erkenntnisreiches Gespräch über seine Stadt.
–
Er erzählt von den Ingenieursstudiengängen in Dresden, deren Teilnehmer „eher konservativ denken, als beispielsweise die Geisteswissenschaftler in Leipzig. Solche Leute besuchen einfach seltener linke Gegendemonstrationen“.
Er kann nicht verstehen, wieso die sächsische Politik sich nicht deutlicher positioniert, wieso kein Bürgermeister oder Regierungsmitglied hier zu sehen ist.
Er erwähnt die dörflich-provinzielle Struktur von Dresden, einer Stadt die neben Altstadt (Touristen) und Neustadt („alternatives Szeneviertel“) keine wirkliche Stadtsubstanz vorweisen kann.
Er spricht davon, sich sicherer zu fühlen, wenn Polizisten aus anderen Bundesländern hier zum Einsatz eingeteilt sind und nicht bloß die sächsischen, denen er zumindest teilweise eine ähnliche Gesinnung zutraut, wie den Zeitgenossen am Bahnhof.
Er redet auch darüber, wie unwohl man sich teilweise hier zwischen dem Schwarzen Block fühlt, wie ihm die Zähne knirschen wenn er der Musik zuhört, die hier gespielt wird. In der Musik geht es auch und vor allem darum, dass Deutschland abgeschafft werden muss, nieder mit dem Staat, nieder mit der Polizei, saufen, saufen, saufen, olé olé! Ich für meinen Teil bin recht froh, dass die Polizei eine Abriegelung zwischen unserem versprengten Grüppchen und mehreren Tausend Pegida-Anhängern bildet. Mit dieser Meinung bin ich hier weitestgehend ein Exot. Immer wieder kommt es zu kleinen Scharmützeln, Wortgefechten, Rangeleien zwischen Hoodyträgern und Polizisten. Schon jetzt denke ich: Leute, da drüben läuft der Feind und ihr regt euch hier über die Polizei auf. Verschwendete Liebesmühe, so viel Kraft und Wut die wirkungslos versandet.
Der Mann spricht von einer einschneidenden Erfahrung, die „so wohl nur hier in Dresden geschehen kann – um nochmal auf ihre Frage zurückzukommen.“ Einmal spazierte er durch die Fußgängerzone und hat eine Familie beobachtet. Der Vater hat seinem Sohn ein Lied vorgesungen. Das Lied ging so:
–
„In Mejdaneck, in Mejdaneck da machen wir aus Juden Speck.
Aus Judenhaut, aus Judenhaut da wird der Lampenschirm gebaut.“
–
Das Lied geht dergleichen weiter. Ich starre ihn sprachlos an ob seines A-Ha-Erlebnisses. Meines findet hier und heute statt.
–
Nach einer ganzen Weile kommt der PEGIDA-Zug  tatsächlich in Richtung unserer Kreuzung marschiert. Ohrenbetäubendes Trillergepfeife von unserer Seite aus, jede Menge Mittelfinger, Hass, Wut, Drohungen. Auf der anderen Straßenseite winken die besorgten Bürger und schwenken ihre Beklopptenfahnen. Ich denke an den Morgen in Heidenau, an den „MITEINANDER“-Schriftzug. Wie um alles in der Welt soll das bitte möglich sein?
tatsächlich in Richtung unserer Kreuzung marschiert. Ohrenbetäubendes Trillergepfeife von unserer Seite aus, jede Menge Mittelfinger, Hass, Wut, Drohungen. Auf der anderen Straßenseite winken die besorgten Bürger und schwenken ihre Beklopptenfahnen. Ich denke an den Morgen in Heidenau, an den „MITEINANDER“-Schriftzug. Wie um alles in der Welt soll das bitte möglich sein?
Ein alter Mann steht plötzlich inmitten des lautesten Gepfeifes direkt vor mir und fragt wieso die Leute so aufgeregt protestieren würden. Ich starre ihn an und deute auf die Meute gegenüber, „wegen der Demonstration dort drüben. Das hier ist die Gegendemonstration.“ „Lasst die doch in Ruhe, die tun doch keinem was!“ sagt er mit einem provokanten Lächeln. Ich starre ihn an, sage nichts. Er starrt mich an, grinsend. Zwei schwarze Kapuzen stehen hinter mir und signalisieren ihm unmissverständlich, zu verschwinden. Er tut wie ihm geheißen. „Das war ein sehr besorgter, das hat man gesehen!“ sagen sie.
Dann ist der Zug an Allmachtsdackeln vorüber gezogen. Per Lautsprecher wird ein gemeinsamer Gang zurück durch die Stadt und zur Abschlusskundgebung am Neustadtmarkt bekannt gegeben. Es wird darum gebeten in einer Gruppe zu laufen. Wir werden von der Polizei durch Dresden eskortiert, was für den Schwarzen Block schon ein recht abstrakter Vorgang sein muss. Mehrfach wird uns ein Deutscher Gruß vom Straßenrand entgegen geworfen, die Polizei greift nicht ein. Dies ist für die Linken wiederum Provokation genug, um sich mit der Staatsgewalt anzulegen, erst durch Sprüche zu provozieren, später durch Aktionen: An eine uns passierende Straßenbahn möchte jemand einen „Refugees Welcome“ – Aufkleber befestigen. Er lässt sich auch von der Polizei nicht aufhalten, diese zieht ihn von der Bahn weg, führt ihn im Polizeigriff neben die Gleise. Alles geht ganz schnell und tatsächlich recht sachlich von statten. Was anschließend geschieht ist Realsatire: Der Lautsprecherwagen und die Demonstranten bleiben stehen und solidarisieren sich mit dem soeben in Gewahrsam genommenen. „Die Polizei riskiert, unsere Demonstranten lebensgefährlich zu verletzen, obwohl diese absolut nichts verbrochen haben… anstatt gegen die Faschisten vorzugehen, die unbehelligt Straftaten wie Hitlergrüße ausüben… wir setzen uns erst wieder in Bewegung, wenn unser Demonstrant freigelassen wurde…“ Und somit steht der Zug für eine gute halbe Stunde still und er steht natürlich neben den Putinisten vom Nachmittag. Unter ihnen ist eine leidenschaftlich aufbrausende ältere Dame mit silbernen Haaren und Megafon, die es sich nun auch nicht nehmen lässt, ihre Meinung hinauszuposaunen: „Einfach nach Hause gehen und Schnauze halten!“ brüllt sie mehrmals in ihr Megafon. Sie erntet: Gepfeife, Geschimpfe, Mittelfinger. Wäre dies alles nicht so traurig und ernst, es wäre garantiert zum Lachen.
In der Neustadt verabschiedet sich der „Herz statt Hetze“ – Mann von mir mit bestem Dank dafür, dass ich an der Gegendemonstration teilgenommen habe. Ich gehe zurück zu meinem Hostel. Direkt davor befindet sich, wie könnte es anders sein, ein Irish Pub. Ganz bitterlich und frustriert betrinke ich mich an diesem Abend, dabei schreibe ich die Eindrücke dieses Tages nieder und bin der Meinung, genug gesehen zu haben um den hoch geschätzten Hanns-Joachim Friedrichs und seine Neutralität hinter mir zu lassen. Ich verspüre einen inneren Drang, mich jenseits der journalistischen Objektivität zu positionieren, denn ich bin ein besorgter Bürger, weil ich mir aufgrund dieser „besorgter Bürger“ sorgen mache. Ich bin auch sicherlich, das wird mir durch meine Sorgen klar, ein Patriot, denn ich fühle mich mit vielem in dieser Nation sehr verbunden, will natürlich das Beste für dieses Land und seine Menschen, für alle anderen aber selbstverständlich auch. Ich möchte Presse- und Meinungsfreiheit behalten, eine demokratische Ordnung bewahrt wissen, Rechtsprechung, Gleichberechtigung und eine ambivalente Zeitungslandschaft nutzen. Ich will keine Zensur, keine gleichgeschalteten Medien und Propagandarundschauen. Ich möchte diesen Aufmarsch nicht verbieten, aber ich möchte leidenschaftlich gerne dagegen sein und protestieren. Liberalität also gepaart mit einer kritischen Grundhaltung und dies bitte ohne den kindischen und retardierten Hass, die Vorurteile und vor allem diese alberne Angst vor dem Anderen und Neuen. Ich möchte diese Fahnen- und Fackelträger, diese vom Kräuterschnaps berauschten Vollidioten nicht in dem Glauben lassen, sie seien eine legitimierte Volksbewegung. Ich möchte auch keinen Staat ohne Polizei oder Parteien, wie es die ganz Linken fordern. Dennoch fällt es mir leichter, mich mit ihnen zu solidarisieren, als mit den Vollidioten und Alpha-Kevins an den Würstchenbuden, die ihren Arm zum Deutschen Gruß heben. Ein mentaler Kraftakt, diese Menschen nicht zu verabscheuen, sondern zu bemitleiden aufgrund ihrer Erziehung, Prägung, all der ganzen kausalen Lawine, die über sie hinwegbrettert und sich „Leben“ nennt.
Im Irish Pub lässt dann ein großartig aufgelegter Barkeeper Jimi Hendrix in Dauerschleife laufen, es gibt tschechisches Bier und irischen Blended, dunkles Licht und Menschen, die gesinnungstechnisch in der besten Bedeutung des Wortes „normal“ daherkommen. Ich freue mich darauf, hier Morgen Hals über Kopf verschwinden zu können und zwar ohne mich umzudrehen.

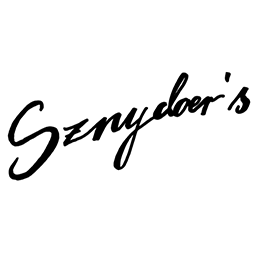



Leave a Reply