HALLE – MERSEBURG – NAUMBURG – BAD SULZA
–

Am nächsten Tag dann wird alles anders.
Ich verlasse die Mädels-WG leicht gerührt und unglaublich dankbar. Zudem bin ich irgendwie erleichtert, dass sich doch jemand hat finden lassen, die ganz selbstverständlich Asyl für eine Nacht anbieten, die mir das Leben erleichtern, obwohl dies nicht zwingend notwendig gewesen wäre – ich leide ja nicht, ich hätte auch Geld für ein Hotel gehabt. Ich umarme beide fest und behalte sie in allerbester Erinnerung.
Ich würde gerne schnell weiter, doch heute erwarte ich gegen Mittag Besuch und deshalb lasse ich mich noch einige Stunden durch Halle treiben – das Bahnhofsviertel hatte ich mir noch nicht angesehen. Dort werde ich häufiger angesprochen als im Rest der Stadt – oder es ist mal wieder nur die Tagesform. Ein Mann wankt vor mir her und quatscht jeden an, der ihm unter die Augen kommt; erst eine Gruppe Girls, Schülerinnen wohl, die er mit seinem breiten Gelalle etwas verschreckt, dann einen sehr dicken Mann der ohne eine Reaktion weitergeht, dann kann der Rest seines peripheren Blickes mich erkennen. Er fragt nach meinem Weg und wirkt aufgekratzt und sehr, sehr schlaflos. Dennoch ist er spontan ein Fan von meinem Unternehmen, wünscht mir jubelnd alles Gute und zündet sich, seinen Mittelfinger in eine Überwachungskamera auf dem Bahnhofsvorplatz reckend, den Rest eines Joints an. „Na, ihr Überwacher, was wollt ihr jetzt dagegen machen, dass ich den hier fertig rauche?“ Er ist mir irgendwie sehr sympathisch in seiner lauten Hoffnarrigkeit. Schief und blechern singend wankt er weiter.
Ein vietnamesischer Kiosk verkauft mir eine Obstschale als zweites Frühstück, ich sitze auf einem weitläufigen Platz in der Nähe des Bahnhofs und schaue die Passanten an. Die Passanten schauen weitestgehend ihre Handys an (die Jungen) oder gar niemanden (die Alten). Eine ältere Dame geht an mir vorbei, sieht mich die Melonen-, Erdbeer- und Mangostücke verschlingen, es ist köstlich. „Na, schmeckt’s?“ fragt sie mit einem Lächeln und ich muss lächelnd antworten „Ich hoffe das sieht man!“ „Ja“ sagt sie, „das sieht man!“ Toll, dieses Ansprechen von Fremden. An den leichtfüßigen, saloppen, dahingegrinsten Sprüchen erkennt man die optimistischen Menschen. Diejenigen, die etwas übrig haben für Kommunikation, Interaktion, für den oder die Unbekannte, für das Leben der anderen und freilich das Leben an sich.
Ich habe noch etwas Zeit für eine zusätzliche Runde durch die Innenstadt und Halle bestätigt den bisherigen Eindruck, gut zu seinen Gästen zu sein erneut ausdrucksstark: Ein Straßenmusikant grinst mich an, unterbricht sein Lied um mich durch Absetzen des Hutes zu grüßen. Grüppchen an Mädchen müssen grinsen, Jungs mit Halbstarkenattitüde machen ohne Ausnahme den Weg frei wenn sie mich sehen, das Stockende auf dem Boden hören, die merkwürdig-feierlichen Wandernadeln in der Sonne glitzernd. Keine Frage: Die Reise gibt mir Selbstvertrauen und verbreitert mein Kreuz, körperlich und metaphorisch. Den Studierenden in den Cafés und vor der Uni bin ich trotzdem weitestgehend egal, sie sind merkwürdigere Anblicke gewohnt und dies ist gut und beruhigend zu wissen. In Halle signalisiert mir eine Stadt „Komm’, Junge! Bleib’ doch noch ein bisschen! Geh’ mit uns in den Studentenbars etwas trinken, lass’ uns diskutieren oder Gemeinsamkeiten finden!“ Das ist, Leipzig außen vor gelassen, neu für mich. Denn der gewohnte Impuls „Schnell weg hier, weiter, weiter!“ rückt in den Hintergrund – und das freut mich sehr.
Ich gehe zurück zum Bahnhof, wo ich einen meiner besten Freunde in Empfang nehme. Er wird mich über das Herrentagswochenende begleiten und ich freue mich sehr auf ihn und seine Gesellschaft.
Er hatte keine Lust, extra früh aufzustehen und erreicht Halle deshalb erst am frühen Nachmittag, was gnadenlos zu spät ist für meinen Standardtagesmarsch mit Gepäck. Ich mahne zum Aufbruch und so führen wir die „Was du nicht alles verpasst hast“ – Unterhaltung auf einer von Halles größten Straßen, hinaus aus der Stadt in Richtung Merseburg.
Dabei müssen wir über eine Schnellstraßenbrücke, auf der zur Zeit Bauarbeiten stattfinden. Wir zwängen uns mit dem Gepäck vorbei an Absperrungen und Baumaterialien und treffen auf einige Arbeiter. Es sind ausnahmslos Ausländer, die im Schatten rasten. Wir fragen sie nach dem Waldweg, der offensichtlich durch ihre Arbeiten versperrt wird. Ihnen ist so ungefähr alles egal, dass wir die Absperrungen passiert haben, dass wir nun in einem Helmpflichtareal vor ihnen stehen und Trampelpfade durch das deutsche Unterholz suchen. Sie deuten uns die ungefähre Route, vorbei an weiteren Zäunen, über ihr Baugerät balancierend. Die deutsche Sicherheitsnorm, sie ist hier bloß eine Geschichte, die man mal gehört hat, vielleicht.
Es ist eine vollends andere Erfahrung, nicht mehr alleine zu gehen. Ich rede wie ein Wasserfall und ohne Unterlass, berichte von meinen Eindrücken und Erkenntnissen, von den Schmerzen, den Glatzen, den Nächten im kalten Zelt, der Handvoll wirklich guter Begegnungen, der Dunkelheit Sachsens, PEGIDA, meinem Scheitern. Ich bin der Missionar des ostdeutschen Backpackings wenn ich mich so reden höre. Und durch dieses Berichten erkenne ich, wie sehr mir diese Reise tatsächlich gefällt. Ich beschönige nichts, ich erwähne auch die durchaus negativen Aspekte und Ereignisse, aber selbst diesen gewinne ich etwas Gutes ab, zumindest behält meine Stimme diese euphorische Färbung.
Mein Freund, der in den vergangenen Wochen immer mal wieder geschrieben hat, wie sehr ihm Berlin derzeit auf die Nerven gehe, wie sehr er ausbrechen möchte und „in die Natur“ gehen will, investiert bei jeder unserer Pausen einige Minuten in eine App, durch die er mit seinen Freunden in Berlin und überall sonst Schach spielen kann. Die Sonne scheint, wir sind in so etwas ähnlichem wie der Natur unterwegs und er verspürt das Bedürfnis, ein Computerspiel zu spielen. Ich bin auf eine recht fassungslose Weise sehr verwirrt über diesen modernen Widerspruch. Dass es den Menschen so schwer fällt, dieses Gerät für einige Tage beiseite zu legen – mehr noch! – für einige Stunden nur. Befremdlichkeit und Abscheu zwischen mir und einer sehr nützlichen Erfindung, die uns fester und deutlicher in der Hand hat, als wir sie – es sind keine neuen Gefühle für mich, aber nach knapp fünf Wochen ohne Internet, eMails, soziale Netzwerke schlägt mir dieser Eindruck wie eine Faust ins Gesicht.
Wir sind langsam. Für mich quälend langsam, für ihn beinahe zu schnell, obwohl wir einen gemäßigten Schritt gehen. Man bleibt doppelt so oft stehen wie zuvor, zum Wasser trinken und lassen, um etwas aus dem Rucksack zu holen oder wieder zu verstauen, um noch eine zu rauchen, um eine Entscheidung zu diskutieren, die man sonst im stillen Gehen mit sich selbst ausmacht. Das reizt mich nicht, ich genieße die Begleitung, aber ich ahne, wie wenig wir in den kommenden Tagen vorwärts kommen werden.
Es sieht nach einem bedrohlichen Gewitter aus, als wir auf Höhe der DOW Schkopau an der Saale entlanglaufen. Bleiben wir hier unter der Brücke? Gehen wir weiter? Ziehen wir die Regenklamotten drüber? Wir wägen mehrfach ab und ich habe bezüglich dieser Art der wolkenformierten Bedrohlichkeit keine bisherigen Erfahrungswerte sammeln können. Wir ziehen die wasserfesten Kleider drüber und gehen weiter. Natürlich bekommen wir keinen einzigen Tropfen ab aber schwitzen in den nicht atmungsaktiven Kleidern alle anderen Textilien nass.
An der Merseburger Saalequelle Arnimsruh machen wir eine Pause. Mir ist klar, dass wir es nicht mehr bis zum Campingplatz schaffen werden, zudem sieht der Himmel noch immer bedrohlich aus und mein Sprunggelenk schmerzt nach langer beschwerdefreier Zeit mal wieder. Ich lasse durchblicken, dass wir vielleicht heute in einer Pension in Merseburg gut aufgehoben wären und meinem Freund vermiest diese Aussicht etwas die Stimmung. Er wollte gerne in die Natur, raus aus den Städten, weg von den Menschen. In dem letzten Punkt kann ich ihn beruhigen, denn obgleich Merseburg über 30.000 Einwohner aufweist, so werden wir die Stadt ab einer bestimmten Uhrzeit für uns alleine haben. Das tröstet ihn nur schwach, aber am Ende siegt die Vernunft. Es beginnt zu regnen, als wir das Schloss erreichen.
Der erste Eindruck: Raben in Käfigen. Weil der Bischof Thilo von Trotha einst vorschnell seinen Diener hat hinrichten lassen, da er ihn zu Unrecht des Diebstahls eines Ringes bezichtigte wie sich später herausstellte, da sich dieser im Nest eines Rabens finden ließ, müssen bis heute Rabenkrähen in einem Käfig büßen. Schöne Scheiße. Was ist das für ein Brauch, bitte? Okay, es ist eine historische Anekdote, die durch diese Fortführung weiterhin bestand hat und an die Geschichte der Stadt erinnert. Immerhin hat der Rabe mittlerweile eine Partnerin. Aber der Impuls, den Käfig nieder zu reißen ist in mir vorhanden. Gestreckte linke Faust, sie bringt euch nichts, aber vielleicht seht ihr in meinem Blick, dass ich lieber einen Bischof hinter feinmaschigem Draht sehen würde, als Euch, meine schwarz gefiederten Freunde. Wieder so was albernes.
Einige Meter weiter stoßen wir auf Erik, der uns sehr verwundert ansieht. Wir grüßen und er grüßt zurück und sehr schnell sind wir dabei, unsere Geschichte zu erzählen. Ob wir keine Angst hätten, fragt auch er uns. Wenn man in seiner afrikanischen Heimat alleine losgeht, einfach so, sei man tot. „Der Busch bringt einen um!“ Er spricht über den Fall eines Mannes, der auszureißen plante, aussteigen wollte aus der Gesellschaft und mit seiner Frau und den Kindern abseits der anderen Menschen in der Natur leben wollte. Aber: „Das ist nichts für eine Frau! Ein Mann kann das, eine Frau braucht diese ganzen Dinge, fließendes Wasser, Schmuck, Make-Up…“ Soweit ich weiß haben Frauen eine deutlich höhere Schmerzgrenze was sehr lange Wanderungen angeht, aber hier geht es nicht um Recht, sondern um Anekdoten. Also lassen wir ihn erzählen, während wir nass geregnet werden und die Raben hinter uns krächzen hören. Dann wird es auch Erik zu regnerisch und er führt uns, hungrig wie wir sind, an einigen Restaurants und Imbissen Merseburgs vorbei, bis sich dieser heiter geteilte Weg vor der Touristen-Information ausgelaufen hat. Wir wünschen ihm alles Gute, und er uns erst.
Bei der Info-Dame fragen wir nach einem Restaurant, was zu empfehlen wäre. Ich lerne hier, dass es nicht „Deutsche Küche“ heißt, sondern „Gutbürgerlich.“ Es gibt indisch, italienisch, thailändisch und eben gutbürgerlich. Die Frau empfiehlt uns ein Restaurant, das wir nach zwanzig Minuten Weg durch den Regen erreichen und geschlossen vorfinden. Sehr viel muss sie ja nicht wissen in ihrem Büro, in ihrem aufs Schwächste frequentierten Tourismus-Informations-Center. Jedenfalls scheint es vermeidbar zu sein, zwei nasse Kerle mit zu viel Gepäck umsonst durch den Regen zu schicken. Mein Freund ist sauer auf sie, wir beide werden gereizt vom Hunger und überlegen kurz, zurück zu gehen und ihr eine sinnfreie Ansage ob ihrer Unwissenheit und amateurhaften Auskunftsqualität zu geben, aber finden eine weitere gutbürgerliche Alternative. Es gibt Pferd für meinen Freund und schallernde Kalauer am Nachbartisch. Vor den Fenstern liegt Merseburg im grauen Regen und lässt auf sich niederplätschern.
Mein Freund lässt sich durch die ermüdende Wirkung des Essens endlich davon überzeugen, dass wir heute eine Pension nehmen sollten. Auch hier ändert sich wieder die Taktik: Habe ich alleine eine Unterkunft gesucht, wurde stets die erstbeste und günstige Möglichkeit angerufen oder -gesteuert. Mit unnötiger Häufung an Kriterien wollte ich mich nicht beschäftigen, ein Bett ist zwar nicht gleich ein Bett – aber für mich war es immerhin ein Bett und damit stets ausreichend. Nun aber Kriterien wie: Aussehen des Hauses, Aussehen des Zimmers, Preis darf abhängig vom Komfort auch höher sein, Lage, Sterne, Barmöglichkeit. Plötzlich bekommt alles eine Bedeutung und fließt in die Stubenwahl mit ein. Er ist mein Gast auf der Tour, hat verhältnismäßig hohe Ansprüche und deshalb gönne ich ihm seine Wünsche. Wir suchen ein Gasthaus aus und ich versuche während und nach dem Essen genau acht mal dort anzurufen, vergeblich. Ich wundere mich, denn ein Gasthaus und Hotel sollte abends zwischen achtzehn und neunzehn Uhr ja irgendwie erreichbar sein, sollten die Besitzer die Absicht verfolgen, irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen. Beim neunten Versuch wird der Hörer abgenommen. Ja, wenn wir uns beeilen würden, könne sie noch etwas machen. „Moment mal bitte, ich versuche seit einer Stunde sie zu erreichen und jetzt sollen wir die Beine in die Hand nehmen? Wir sitzen noch beim Essen!“ Achso, jaja, man war unterwegs, eine Angestellte wäre aber noch da, auch über eine halbe Stunde hinaus, sicherlich. Jetzt habe ich sie am Wickel, die mangelnde Professionalität ist ihr nun unangenehm. „Wir verlassen uns aber darauf, dass jemand vor Ort ist, wenn wir ankommen – nicht, dass wir wieder neunmal irgendwo anrufen müssen und niemand ans Telefon geht, ja?!“ großkotze ich in den Hörer und die Dame ist ganz auf „jaja“ und „gewissgewiss!“
Wir lassen uns Zeit mit dem Essen, beobachten wie am Nachbartisch selbiges aus allen Winkeln fotografiert wird, Foodporn mit Pferd und Klößen. Als wir das Restaurant verlassen, schaut uns jeder und seine Mutter an. Ich möchte wissen, was und wie sie über uns denken: Ein schwules Paar? Alternative Bombenleger? Gesellen ohne Kluft? Was zur Hölle haben die hier in Merseburg verloren? Alles legitime Ansätze.
–
 Wir erreichen unser Hotel und finden eine merkwürdig zerstreute Angestellte vor. Mein Freund hat bereits am ersten Tag verstanden, dass die Spätikultur außerhalb Berlins nicht existent ist und fragt nach einem Restaurant, um noch ein Bier zu kaufen. Die Frau überlegt kurz. „Naja, gegenüber ist so’n Asiate, ich weiß ja nicht ob ihr sowas esst…“ „Sowas“ – mit einem Wort sagt sie alles notwendige um jegliche Gesinnungsfrage im Ansatz zu klären. Schönen Abend noch, wir gehen jetzt mal Enten am benachbarten See anschauen. Diese zu füttern ist hier aber unerwünscht, könnte Ratten anlocken. Die Enten sind so ausgehungert, dass mir eine von ihnen in den Finger beißt. Muss die Aufregung sein, dass sich mal jemand zu ihnen setzt, denn Merseburg, das ist klar, hat wenig übrig für Feierabendspaziergänger, Draußenseier, Entenfütterer.
Wir erreichen unser Hotel und finden eine merkwürdig zerstreute Angestellte vor. Mein Freund hat bereits am ersten Tag verstanden, dass die Spätikultur außerhalb Berlins nicht existent ist und fragt nach einem Restaurant, um noch ein Bier zu kaufen. Die Frau überlegt kurz. „Naja, gegenüber ist so’n Asiate, ich weiß ja nicht ob ihr sowas esst…“ „Sowas“ – mit einem Wort sagt sie alles notwendige um jegliche Gesinnungsfrage im Ansatz zu klären. Schönen Abend noch, wir gehen jetzt mal Enten am benachbarten See anschauen. Diese zu füttern ist hier aber unerwünscht, könnte Ratten anlocken. Die Enten sind so ausgehungert, dass mir eine von ihnen in den Finger beißt. Muss die Aufregung sein, dass sich mal jemand zu ihnen setzt, denn Merseburg, das ist klar, hat wenig übrig für Feierabendspaziergänger, Draußenseier, Entenfütterer.
–
Am nächsten Morgen sieht mein Freund aus wie ich in den ersten Tagen der Wanderung: Schmerzverzerrt, verbissen, leidend. Obgleich ich ihn natürlich ungern Schmerzen durchmachen sehe, so ist dieser Anblick innerlich äußerst beruhigend für mich: Ich bin normal! Es ist scheinbar unumgänglich, sich unter tatkräftiger Mithilfe von zu viel Gepäck diverse Blasen und Schmerzen zu erlaufen. Jetzt kann ich ihn etwas aufziehen und necken, ob er sich nicht freue, dass wir gestern nicht noch zum Campingplatz gelaufen sind, ob er sich nicht freue über den Komfort einer Matratze? Zähneknirschendes Nicken.
Die Lobby des Hotels muss noch in einem Bild festgehalten werden – sie ist ein fusionierter Albtraum aus Wellblech, Terracotta und schlimm gefärbten Sitzbezügen. Die Angestellte von gestern Abend beobachtet mich argwöhnisch, traut sich allerdings nicht, auch nur ein Wort der Verwunderung oder des Protests auszusprechen. Weiß sie wohl auch nicht, warum wir „sowas“ machen.
–
Wir steuern einen Supermarkt an und kaufen Proviant für die Tagestour. Im Vorraum befindet sich eine Bäckerei, erst mal Kaffee und Käsebrötchen zum Frühstück für uns zwei. Ich frage die beiden Bäckereifachverkäuferinnen nach dem Weg zur Saale, an der wir uns heute bis nach Naumburg entlang schlängeln wollen. Beide schauen mich fragend an. Ich werde konkreter. „Die Saale. Der Fluss. Der Fluss, der durch diese Stadt fließt.“ Sie schauen noch immer verwundert, sie wissen es nicht, sie wissen nicht einmal wovon ich hier spreche. Fassungslosigkeit. Noch ein Versuch, Entschuldigung, die Saale, ihr Fluss hier in diesem Ort. Keine Chance. Als eine von ihnen ihr Smartphone zückt, um den Google-Kartendienst zu befragen, winke ich ab. Ich lasse sie stehen, zu verblüfft um genervt zu sein, zu amüsiert um verärgert zu sein.
Ein älterer Herr gibt uns auf dem Supermarktparkplatz den entscheidenden Tipp. Endlich setzen wir uns in Bewegung. Zwei Leute die frühstücken, benötigen länger als einer. Zwei Raucher benötigen mehr Zeit zum rauchen als einer. Vier Schuhe benötigen mehr Zeit um geschnürt zu werden, als zwei. Das ist alles so, unabwendbar. Immerhin: Wir laufen, doch wir laufen mit wenig Orientierung und im Zick-Zack-Kurs durch Merseburg, dann auf eine Flussinsel zu, direkt in die falsche Richtung, umdrehen nun, wieder zurück, es ist frustran bevor es richtig beginnt an diesem Tag. Schließlich erreichen wir den Saale-Wanderweg und mein Freund fragt nach der ersten Pause. Blasen, aufgescheuerte Haut, drückende Schuhe und wir sind lediglich ein paar hundert Meter Luftlinie voran gekommen. Bis Naumburg allerdings sind es 30km. Er beißt auf die Zähne. Wir machen die erste Rast kurz hinter Merseburg, kurz nachdem wir an zwei Männern vorbeilaufen, die sich auf einer Parkbank sitzend Wodka gönnen und uns reibeisenstimmig grüßen. Es ist kurz nach neun an einem grauen Morgen voll schneidendem Wind und rasch mit dem Licht spielenden Wolken.
So gehen wir weiter heute. Alle zwanzig Minuten gibt es die Notwendigkeit einer Rast oder kurzen Pause. Ich schaue in ein gequältes Gesicht, sehe seine Frustration über die Distanzangaben auf den Schildern, die öfters variieren – mal werden sie zwei Kilometer weniger, dann wieder grundlos mehr, obwohl wir auf dem selben Weg bleiben. Ich habe in der ersten Woche aufgehört, mich auf diese Schilder zu verlassen, zu sehr verknüpft man seine Hoffnungen und Kräfte mit diesen Distanzangaben und wird dann wieder enttäuscht und demotiviert. Mein Freund klammert sich an diese Angaben und wird wütend, wenn sie plötzlich wieder länger werden. „Da hinten müsste Weißenfels sein“ höre ich ihn sagen über einen Ort, der sich etwa zwei Kilometer vor uns ausbreitet. Es kann unmöglich Weißenfels sein, aber ich möchte ihn nicht enttäuschen. Bis Weißenfels sind es noch knapp zehn Kilometer.
Er findet eine Aubergine am Straßenrand und nimmt sie für einige Kilometer mit. Er schnitzt sich einen Stock und verbiegt dabei ziemlich grobmotorisch mein Messer, mit Gewalt will er es einklappen. Ich treibe ihn durch schnelle Schritte phasenweise gnadenlos an, denn ich mag es mir nicht leisten, jeden Tag lediglich zehn Kilometer voran zu kommen. Ich freue mich über Gesellschaft, aber kann nicht auf meinen Anspruch verzichten, voran zu kommen. Er bremst mich aus und muss dringend motiviert werden. Für ihn ist es ein Kurzurlaub, für mich eine Herzensangelegenheit. Der Marsch wird zu einem Kampf.
–
 Mit Ach und Krach schaffen wir es gute zwanzig Kilometer bis nach Weißenfels. Kurz vor dem Bahnhof laufen wir über ein erstaunlich unkrautüberwuchertes und der Ödnis preisgegebenes Gelände – mit einer Kegelbahn. Es stehen tatsächlich Autos vor diesem Gebäude. Wer bitte geht hier im wöchentlich nachmittäglichen Sonnenschein kegeln? Automatisch denke ich an die „Freizeitvereine“ in Mecklenburg. Zwangsläufig vermute ich drinnen kleine Landser-Feiereien und Nazi-Rock-Konzerte. Mein Misstrauen der Ostdeutschen Freizeitgestaltung gegenüber hat in ungesundem Maße zugenommen. Ich sollte wieder anfangen, in den Menschen zuerst einmal das gute zu sehen und denke daran, dass Hitler Nichtraucher, Vegetarier und Tierfreund war. Mit diesem Gedanken lässt sich diesbezüglich arbeiten.
Mit Ach und Krach schaffen wir es gute zwanzig Kilometer bis nach Weißenfels. Kurz vor dem Bahnhof laufen wir über ein erstaunlich unkrautüberwuchertes und der Ödnis preisgegebenes Gelände – mit einer Kegelbahn. Es stehen tatsächlich Autos vor diesem Gebäude. Wer bitte geht hier im wöchentlich nachmittäglichen Sonnenschein kegeln? Automatisch denke ich an die „Freizeitvereine“ in Mecklenburg. Zwangsläufig vermute ich drinnen kleine Landser-Feiereien und Nazi-Rock-Konzerte. Mein Misstrauen der Ostdeutschen Freizeitgestaltung gegenüber hat in ungesundem Maße zugenommen. Ich sollte wieder anfangen, in den Menschen zuerst einmal das gute zu sehen und denke daran, dass Hitler Nichtraucher, Vegetarier und Tierfreund war. Mit diesem Gedanken lässt sich diesbezüglich arbeiten.
–
Am Bahnhof warten wir gemeinsam mit Soldaten und Soldatinnen auf die nächsten Züge in Richtung ihrer Kasernen oder in unserem Fall nach Naumburg. Gegenüber von unserem Bahnsteig bröckelt ein beeindruckendes Fundament vor sich hin. „Versorgungskontor – Industrietextilien“ steht in riesigen maroden Lettern gerade noch entzifferbar an den gigantischen Hallen. Vor hundertzwanzig Jahren ließen sich in Weißenfels 45 Schuh- und Schaftfabriken finden. Vor dreißig Jahren noch wurden drei Viertel aller Schuhe der DDR hier produziert. Heute schauen mein Freund und ich auf das vermutlich größte zusammenhängende Loch der Welt. Glas und Steine, Scherben und Brocken.
–
–
Die letzten drei, vier Kilometer, die wir nach der kurzen Zugfahrt vom Naumburger Bahnhof bis zum Campingplatz laufen müssen, zwingen meinem Freund sowohl körperlich als auch moralisch beinahe auf meine tatsächliche Augenhöhe hinab. Er flucht zornig vor sich hin, wenn er in seiner Wortkargheit überhaupt noch etwas sagt. Ich komme aus dem Grinsen kaum heraus und könnte auch nachvollziehen, wenn er mir im Stile seines großen Vorbildes Carlo Pedersoli eine mit der prallen Faust auf meinen kleinen Kopf drücken würde. Macht er aber erst einmal nicht, denn er ist ein guter Freund.
Der Campingplatz ist gut gefüllt, das verlängerte Herrentagswochenende steht an und so werden die Grünflächen insbesondere von Männergruppen bevölkert, die alberne Plakate aufhängen, lokalkolorisierte Fahnen hissen, befremdlich lächerliche Hüte tragen und eine für den späten Nachmittag unglaubliche Motorik zur Schau stellen. Die Campingsaison beginnt heute definitiv, und wie es aussieht beginnt sie vor allem hier in Naumburg an der Saale. Mein Freund möchte heute nichts mehr, nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, nur noch liegen und schlafen. Es sei ihm gegönnt.
–
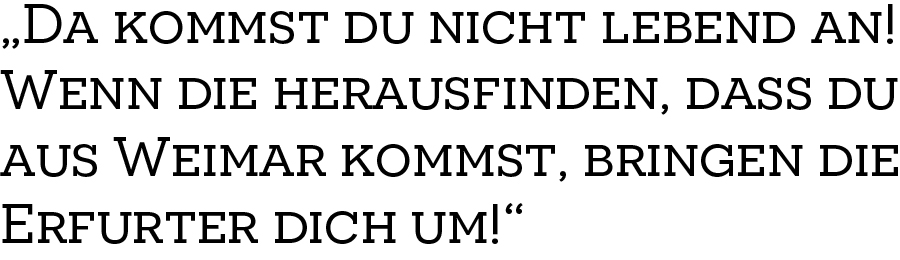 Am nächsten Morgen werden wir sehr früh von schallender Schlagermusik geweckt. Kaum ein Mensch ist um diese Zeit bereits aus seinem Zelt gekrochen, doch Vicky Leandros und Drafi Deutscher brüllen schon jenseits sämtlicher Schmerzgrenzen und Tagesformen über das Areal. Jetzt sehen wir alles bei und somit in einem anderen Licht: Wir können Gruppen erkennen, die vier Tage vor allem zum Saufen hierher fahren aber auch sportliche Kleinfamilien. Um uns herum werden also entweder die ersten Bierflaschen geöffnet oder die Fahrradtaschen gepackt, die Paddelausrüstungen verstaut, die Wanderschuhe geschnürt oder die Kinder eingecremt. Es ist in etwa eine Atmosphäre wie auf einem kleinen Festival – jeder macht sich auf zu seiner Lieblingsbühne. Doch hier spielen keine Bands. Hier fließen Saale und Unstrut, hier verlaufen Pfade flach entlang an Ufern oder steiler hinauf in mittlere Höhen. Die Sonne strahlt und die Menschen sind in Feiertagsstimmung. Endlich, denke ich, bin ich nicht mehr alleine draußen unterwegs.
Am nächsten Morgen werden wir sehr früh von schallender Schlagermusik geweckt. Kaum ein Mensch ist um diese Zeit bereits aus seinem Zelt gekrochen, doch Vicky Leandros und Drafi Deutscher brüllen schon jenseits sämtlicher Schmerzgrenzen und Tagesformen über das Areal. Jetzt sehen wir alles bei und somit in einem anderen Licht: Wir können Gruppen erkennen, die vier Tage vor allem zum Saufen hierher fahren aber auch sportliche Kleinfamilien. Um uns herum werden also entweder die ersten Bierflaschen geöffnet oder die Fahrradtaschen gepackt, die Paddelausrüstungen verstaut, die Wanderschuhe geschnürt oder die Kinder eingecremt. Es ist in etwa eine Atmosphäre wie auf einem kleinen Festival – jeder macht sich auf zu seiner Lieblingsbühne. Doch hier spielen keine Bands. Hier fließen Saale und Unstrut, hier verlaufen Pfade flach entlang an Ufern oder steiler hinauf in mittlere Höhen. Die Sonne strahlt und die Menschen sind in Feiertagsstimmung. Endlich, denke ich, bin ich nicht mehr alleine draußen unterwegs.
Wir frühstücken in Sichtweite der ohnehin unüberhörbaren Djs, die aus einem Bretterverschlag neben dem obligatorischen Wellblechhangar heraus den Ton angeben. Die beiden sind zusammen gute hundertfünfzig Jahre alt und hauen alles raus, was man so mitschunkeln oder singen kann, in welcher Verfassung man sich auch immer befinden mag. Begrüßungssong zum Frühstück: „20 Zentimeter“ von Möhre. Das lassen wir uns nicht sehr lange gefallen, zumindest nicht ohne einen Frühschoppen. So scheint man das hier ertragen zu wollen.
Beim Blick auf die Blasen meines Freundes entscheiden wir, den heutigen Tag ohne Wanderrucksäcke zu verbringen und uns im Müßiggang auf der Saale treiben zu lassen. Wir reservieren uns einen Kanadier für den Nachmittag und überbrücken die Wartezeit bis zum Beginn der Paddeltour mit einem weiteren Bier. Umgang färbt schließlich ab. Wir assimilieren uns mit der Mehrzahl der campenden Bevölkerung, die mittlerweile bereits häufiger grölend – immer, immer wieder: „Atemlos!“ – und Bollerwagen hinter sich her wuchtend durch die pittoreske Umgebung ziehen möchte, schnell vorher allerdings, ähnlich wie wir, eins, zwei, drei, vier, viele Pils am Pilz vorglühen möchte. Festzeltstimmung unter freiem Himmel.
Während wir auf die Abfahrt unseres Bootstaxis warten, werden wir von einer angetrunkenen Meute junger Männer gefragt, was uns am Herrentag hierhin verschlägt, wenn wir schon in Berlin leben. Überhaupt: Berlin! Berlin!!! Sie können es nicht fassen. Allgemeines Kopfschütteln. Einer von ihnen möchte sich unbedingt messen, in allen möglichen und unmöglichen Kategorien. Er möchte herausfordernd Größen vergleichen und bewerten, bezweifelt, dass wir in Berlin leben, glaubt mir nach einem Blick auf meine Waden nicht, dass ich seit Wochen zu Fuß unterwegs bin, hält es für unsinnig, dass mein Freund so groß ist, wie er behauptet zu sein und auch tatsächlich ist, lacht uns folgend aus, während er mehrfach über seine eigenen Füße stolpert. Wir lassen ihn so strutzedoof wie er daherkommt dahingehen, denn das Glück soll ja mit den Dummen sein. Einer seiner Kumpels ist ein netter Zeitgenosse. Er überlässt uns seine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 und rät mir dringend davor ab, von Weimar nach Erfurt zu wandern. „Da kommst du nicht lebend an! Wenn die herausfinden, dass du aus Weimar kommst, bringen die Erfurter dich um!“ Staunen. Wie bitte? „Das ist brandgefährlich!“ legt er nach. „Brandgefährlich wegen Linken oder wegen Rechten? Wovon sprichst du denn bitte?“ Er meint wahrhaftig ernst was er da behauptet, aber er kann auch nicht wirklich erklären, warum mir dort der Tod droht. Es bleibt bei der Todesdrohung an sich. Naja, danke für die Sonnencreme, schönen Herrentag noch und geht nicht ertrunken.
–
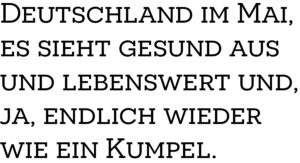 Dann setzt sich unser Shuttleservice Richtung Bootseinstieg endlich in Bewegung. Unser Paddelerklärer ist ein wundervoller Mensch. Seine Augen leuchten, als wir ihm Fragen über die Region stellen, die Stadt, den Wein, Nietzsche. Er berichtet über die Besonderheiten der Muschel- und Kalkschichten in den Gesteinsformationen an der Saale und der Unstrut, schwärmt vom Sekt aus Freyburg, referiert über die Himmelsscheibe von Nebra. Oft kämen die Leute bloß zum Saufen, selten frage mal jemand nach Besonderheiten der Region. Ich erkundige mich nach der Rivalität zwischen Erfurt und Weimar, erzähle von der kruden Todesankündigung kurz zuvor im Campingplatzbiergarten. „Jaja, das gibt es! Aber ich würde dir eher Erfurt empfehlen. Mehr los, mehr Studenten, Landeshauptstadt. Weimar trägt die Nase ziemlich weit oben!“
Dann setzt sich unser Shuttleservice Richtung Bootseinstieg endlich in Bewegung. Unser Paddelerklärer ist ein wundervoller Mensch. Seine Augen leuchten, als wir ihm Fragen über die Region stellen, die Stadt, den Wein, Nietzsche. Er berichtet über die Besonderheiten der Muschel- und Kalkschichten in den Gesteinsformationen an der Saale und der Unstrut, schwärmt vom Sekt aus Freyburg, referiert über die Himmelsscheibe von Nebra. Oft kämen die Leute bloß zum Saufen, selten frage mal jemand nach Besonderheiten der Region. Ich erkundige mich nach der Rivalität zwischen Erfurt und Weimar, erzähle von der kruden Todesankündigung kurz zuvor im Campingplatzbiergarten. „Jaja, das gibt es! Aber ich würde dir eher Erfurt empfehlen. Mehr los, mehr Studenten, Landeshauptstadt. Weimar trägt die Nase ziemlich weit oben!“
–
Während wir dann unsere klirrenden Bierflaschen in das Boot laden, klärt er uns schmunzelnd über die Regeln auf. Es gibt eigentlich nur eine: Keinen Alkohol. Allgemeine Heiterkeit. Wenn wir aufmerksam sind, können wir vielleicht Eisvögel sehen, zwei Paare nisten derzeit an den Ufern. Wir sehen keine Eisvögel, stattdessen ungezählte Biervögel in Kanus, auf Flößen, in Schlauchbooten, an den Ufern. Die Landschaft ist voll mit Beschallungsanlagen tragenden Gruppen junger Männer, berauscht-grölendes Testosteron wohin das Auge schaut und natürlich ein wankender gegen-einen-Baum-Pinkler alle vierzehn Schritte.
Manchmal sind auch Frauen unter den Gruppen. Das sieht dann meistens so aus, dass zwei oder drei befreundete Paare einen Ausflug unternehmen und sich jeweils die Männer und die Frauen separate Boote teilen. Die Männer treiben in aller Regel sehr lautstark und unverständlich vorneweg, einer fällt immer irgendwie ins Wasser oder hampelt storchig über das Boot, während die Frauen im Boot dahinter eher mitleidig kichern und den pubertären Ist-Zustand ihrer Gatten augenzwinkernd und gönnerhaft zur Kenntnis nehmen.
Anders als beim Wandern müssen wir hier wenig Mühen auf uns nehmen um die Welt an uns vorüberziehen zu sehen. Die Seelen treiben auf der Saale vor sich hin, wir sind eine stille und genügsame Grinseparade in einem zwei-Mann-Kanadier.
Man grüßt sich, man winkt sich zu. Ahoi! Die Naherholungssaison hat begonnen und mit ihr erwacht Deutschland aus seinem Winterschlaf und wankt in einen ersten sonnigen Maibockrausch. Es ist phantastisch und atmosphärisch zum verlieben. Das Land wirkt versöhnlich, die bierselige Feiertagslaune und das Kaiserwetter verändern die Wahrnehmung der vergangenen Wochen, wischen Lethargie und Biedermeier hinfort, die ganze Welt scheint hier und heute unterwegs zu sein. Deutschland im Mai, es sieht gesund aus und lebenswert und, ja, endlich wieder wie ein Kumpel.
–
Wir kehren auf halber Strecke in einem hoch frequentierten Gasthaus ein.  Das Festbinden des Bootes wird zu einer wahren Aufgabe, die wir, Gelenksteffen und Körperklaus in Personalunion, etwas grobmotorisch aber mit trockenen Füßen meistern. Auch mein laienhafter Doppelknoten wird halten, hoffentlich. Der Biergarten ist zum Bersten ge- und befüllt, die Bedienungen tun mir leid und werden hoffentlich mit fürstlichen Trinkgeldern entlohnt. Wir essen als wäre es das letzte Mahl.
Das Festbinden des Bootes wird zu einer wahren Aufgabe, die wir, Gelenksteffen und Körperklaus in Personalunion, etwas grobmotorisch aber mit trockenen Füßen meistern. Auch mein laienhafter Doppelknoten wird halten, hoffentlich. Der Biergarten ist zum Bersten ge- und befüllt, die Bedienungen tun mir leid und werden hoffentlich mit fürstlichen Trinkgeldern entlohnt. Wir essen als wäre es das letzte Mahl.
Drinnen an der Theke möchte ich mir noch ein Eis kaufen. Ich bin nicht der einzige, eine ganze Schlange wartet darauf abgearbeitet zu werden. Als der Mann vor mir an der Reihe ist, wird es plötzlich hektisch. Er muss für sich, seine Frau und drei Kinder Eis bestellen und niemand von ihnen hat sich zuvor Gedanken darüber gemacht, was sie möchten. Es wird diskutiert, „Nu mach!“ keift die Mutter und alle wieder durcheinander „…ähm… Cali.. nein, doch, nee… lieber mit Schoko!“ und der Vater merkt irgendwie nicht, dass das hier gerade ungünstig ist, für ihn, für die Bedienung, für die anderen Kunden. Stau auf der A-Eis. Die Bedienung aber registriert es und wendet sich an mich, es muss ja schließlich: Weiter gehen. Ich bestelle hurtig und während die Bedienung nach hinten zur Eistruhe eilt, haut der Familienvater zornig seine Faust auf den Tresen. „So ein verdammter Sauladen! Kann doch nicht sein dass hier drei Leute gleichzeitig bestellen, ich bin an der Reihe!“ Ich schaue an ihm hinauf. „Vielleicht sollten sie einfach vorher entscheiden, was sie möchten.“ „Schnauze!“ Das sagt er so zu mir hinunter und ich kann nicht anders als ihn direkt, spontan und laut auszulachen. Ich muss mich am Tresen festhalten, kann und mag gar nichts mehr entgegnen, denn alles ist gesagt worden mit diesem einen Wort. Mein Eis ist ausverkauft, ob ich ein anderes möchte, fragt die Bedienung als sie zurückkehrt. Sie hat den Ausbruch nicht mitbekommen, doch ihre Kolleginnen hinter dem Tresen haben diesen uiuiui-Blick aufgesetzt und bemühen sich, Ruhe zu bewahren, während sie den Choleriker und mich abwechselnd beäugen. „Bedienen sie erst mal den Herren hier, bevor er sich vergisst.“ Das dauert dann natürlich wieder zwei, drei Minuten bis die Bestellung ausgewählt und angesagt ist und nun ist auch er erhitzt und hetzt und flucht. Ekel-Alfred im hautengen Lycra-Shirt, in tennisbesockten Sandalen, zu scheußlich und zu vollkommen um wahr zu sein – es ist der typisch-deutsche Jähzorn, mit dem er hier fachmännisch hantiert. Mentale Pickelhaube an der Eistheke. Als sie ihr Eis bekommen hasst er die Welt, er hasst seine Bälger, er hasst mich – und ich hoffe er hasst sich selbst auch ein bisschen. „Na dann noch einen schönen Herrentag!“
Wir lassen uns den Rest des Weges treiben, erst kurz vor dem Ziel müssen wir etwas paddeln, durch einige leichte Stromschnellen manövrieren und den Kanadier um ein Wehr herum tragen. Auf der Höhe unseres Campingplatzes traue ich meinen Augen kaum: Hier findet ein Rave statt! Da steppen und stampfen fünfzig Leute zu extrem lauter Deep-Housemusik. Mein Blick ist begeistert, der meines Freundes angewidert. Wir hieven das Boot aus dem Wasser und säubern es, ich habe es jetzt sehr eilig. Mein Freund möchte erst einmal zum Zelt, umziehen, locker machen, dergleichen. Ich will mir jetzt aber diesen Tumult ansehen und somit haben wir einen gewissen Konflikt. Er möchte weg von den Menschen und ich habe vier Wochen lang so wenige von ihnen gesehen, erst recht nicht in der eben dargebotenen Stimmung, dass es mich kaum in meiner Haut, vor allem aber nicht in der Nähe unseres Zeltes hält. Ich kann ihn zumindest dazu überreden, mich nach vorne zum Biergarten zu begleiten und sich die Meute mit mir anzusehen. Bevor es dann spannend wird, hält vor uns und vor dem DJ-Pult mit den noch immer munteren Rentner-Guettas ein Konvoi der Polizei. Zwei Dutzend Beamte marschieren schnurstracks und zielstrebig in Richtung des Raves. Naja. Erstmal ein Bier hier trinken und schauen was passiert. Der Holzmichl lebt also noch, und alle singen mit. Die Musik des Raves verstummt derweil und ruckizucki sind die Polizisten wieder zurück, mit angespannten Armen garstig ihre Schlagstöcke umklammernd. Türen zu, rückwärts ausgeparkt und vorbei ist es mit der elektronischen Tanzveranstaltung. Was wäre ich dort glücklich geworden.
Wir benötigen nun einen Plan für den nahenden Abend: Ich kann bei dem Boots- und Fahrradverleiher Prozente als guter Kunde heraus handeln, indem ich damit argumentiere, dass ich Vegetarier bin und heute hier am Platz lediglich Bratwürste angeboten werden, weshalb wir nochmals in die Stadt radeln müssten. Er wäre eher geneigt, mir als Vegetarier das Doppelte des Preises abzuverlangen, spricht er mit dem Grinsen eines Chefs, dem heute Wetter und Feiertag einen hervorragenden Saisonstart beschert haben. Verhandeln in Deutschland. Beruhigend, dass auch das mitunter funktioniert.
In Naumburg drehen wir in der goldenen Stunde ein paar Runden durch die wunderschöne Altstadt. Ich bin ja selbst ein Naumburger, da ich in dem zweiten deutschen Naumburg in Nordhessen aufgewachsen bin, einem sehr hübsch zwischen mehrere kleine Hügel geschmiegten Ort an der Elbe, einem kleinen Fluss, der wenig mit der kräftigen und rauen Elbe zu tun hat, die ich in den vergangenen Wochen so oft überquert habe, aber natürlich dennoch einen klangvollen Namen hat. Meine kleine katholische Enklave Naumburg hat einen wunderschönen Stadtkern aus jahrhundertealtem Fachwerk, der heuer sehr tot darnieder liegt, da jeder der es sich leisten kann ein Einfamilienhaus an den Stadtrand baut. Nun ist es in Naumburg an der Saale schwer zu sagen, ob sich wirkliche Naumburger in den Eisdielen und Restaurants aufhalten oder es sich bei ihnen mehrheitlich um Zugezogene oder Touristen handelt, die sich den Dom, den Marktplatz und die anderen Sehenswürdigkeiten anschauen. Jedenfalls: Es ist zumindest ordentlich was los und das freut mich für diesen Ort.
Ein Junge und zwei Mädchen, alle um die fünfzehn Jahre alt, albern auf einem Platz herum. „Entschuldigung, seid ihr von hier? Wir suchen das Haus von dem Typen mit dem lustigen Bart.“ Stille. Noch ein Versuch: „Nietzsche! Das Nietzsche-Haus, das soll hier irgendwo sein, da hinten steht es auf den Schildern. Der hat mal hier gelebt…“ „Entschuldigung, mit sowas kennen wir uns nicht aus.“
Das Haus ist tatsächlich nur hundert Meter weiter die Straße hinunter und so stolpere ich dann auf dieser Reise über Friedrich Nietzsches Spuren, ohne dass ich es geplant hätte.
Mit dem Gefühl, genug für einen Tag erlebt und gesehen zu haben, zieht es uns nun in den Ratskeller, der neu und hervorragend renoviert wurde und von hallendem Leben erfüllt wird. Männerrunden beim Kartenspielen und Pärchen, die der Herrentag kalt lässt. Und wieder: Pferd und Spätzle. Ein Traum.
Bierselig und erschlagen von diesem Tag voller Eindrücke des süßen Lebens fahren wir zurück zum Campingplatz und schlafen den Schlaf der Gerechten während um uns herum noch die Reste des Herrentages zelebriert und weggetrichtert werden.
–
 Der nächste Morgen am Campingplatz: Eine junge Frau macht Yoga am See, um sie herum erledigen die Camper ihre Morgentoilette: Badelatschengeklatsche legt sich über die Stille, durch die Gegend getragene Klopapierrollen wehen im Laufwind, trompetendes Säubern der Nasennebenhöhlen. An der Campingplatzgastro genehmigen sich zwei vollschlanke Herren ein Sekt- und – Rühreifrühstück. „Leggor, einfach nur leggor!“ sagt der eine, der zweite nickt schmatzend. Wir bauen unser Zelt ab, entsprechend unserer Gruppendynamik recht ungehetzt und langsam. Bis wir uns auf den Weg zurück nach Naumburg machen wird es Vormittag. In der Nähe des Doms genehmigen wir uns ein luxuriöses Frühstück, es ist einfach nur: „Leggor“.
Der nächste Morgen am Campingplatz: Eine junge Frau macht Yoga am See, um sie herum erledigen die Camper ihre Morgentoilette: Badelatschengeklatsche legt sich über die Stille, durch die Gegend getragene Klopapierrollen wehen im Laufwind, trompetendes Säubern der Nasennebenhöhlen. An der Campingplatzgastro genehmigen sich zwei vollschlanke Herren ein Sekt- und – Rühreifrühstück. „Leggor, einfach nur leggor!“ sagt der eine, der zweite nickt schmatzend. Wir bauen unser Zelt ab, entsprechend unserer Gruppendynamik recht ungehetzt und langsam. Bis wir uns auf den Weg zurück nach Naumburg machen wird es Vormittag. In der Nähe des Doms genehmigen wir uns ein luxuriöses Frühstück, es ist einfach nur: „Leggor“.
Der Weg führt uns durch Naumburgs Altstadt, dann an einer lauten Hauptstraße entlang einen steilen, langen Hügel in der Mittagssonne hinauf, und dann haben wir ein wunderschönes Stück talwärts durch einen schattig-kühlen Wald vor uns, bis wir in Bad Klösen heraus kommen. Uns wird von einer wahnsinnig hübschen und sympathischen Angestellten in der Touristen-Information ein Biergarten empfohlen, den wir uns natürlich nicht zweimal empfehlen lassen müssen. Dort ist jeder Tisch besetzt und mein Freund will direkt wieder weiter und eine Alternative suchen, aber nicht mit mir! Ich will fragen, ob wir uns zu drei Herren setzen können, die noch Platz in ihrer Runde haben und rolle mit den Augen, als mein Freund anmerkt „meinst du das sind solche Typen?“ Wie, was für Typen? Was ist das für eine Frage, denke ich und frage die Herren, die natürlich einladend „Bitte, Bitte!“ sagen und uns zu sich winken. Die drei kennen sich seit der Studienzeit aus Leipzig und verbringen seitdem das Herrentagswochenende gemeinsam. „Überall!“ waren sie schon, „in Kandinskys Wohnzimmer haben wir schon geschlafen!“ Über Beziehungen. Man kannte da mal jemanden. Wir verstehen uns sofort und blendend, obwohl die drei sich im Rentenalter befinden. Wir drehen uns Zigaretten und der eine, der bärtige und sympathischste von allen dreien schreit durch den Biergarten „Sieh’ dir die Jugend von heute an! Alles Luschen! Keiner raucht Marihuana, wo ist die revolutionäre Energie?!“ Wir überschlagen uns vor lachen. Schulterschlusslaune. Wir lästern über die Ewiggestrigen in diesem Land, die momentan so laut und stumpf durch die Straßen und die digitalen Räume marschieren, dass einem Angst und Bange werden kann. Es befinden sich garantiert Menschen in diesem Biergarten, denen unser Ton und Gesprächsinhalt nicht gefallen mag. Das Paar neben uns zum Beispiel: Es wird sehr still, spitzt die Ohren und verabscheut uns ihrer Mimik nach zu urteilen ähnlich, wie wir die braune Soße missachten, über die wir gerade herziehen. Der Wortführer von den dreien ist „alter Sozi“ und spricht wie ihm Schnauze und Herz gewachsen sind. Er raunt nun die Bedienung an, ob sie „was zum Rauchen“ habe, drinnen befinde sich ein Zigarettenautomat, entgegnet diese. „Nein! Gras!“ schreit er sie an und wir schreien vor lachen gleich mit und prosten uns zu. Der bärige Typ, der mir so sympathisch ist, dass ich ihn gerne für den Rest der Reise mitnehmen möchte, spricht dann noch über die Parallelen zwischen Hitler und Bachmann. „Schau’ wie das damals war! Da kommt ein kleiner, verkrüppelter, dunkelhaariger Österreicher hierher und sagt den Deutschen, wie Deutsche auszusehen haben. Heute kommt ein verurteilter Verbrecher und Hetzer, dumm wie ein Kastenbrot und will den Deutschen erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Und die Deutschen finden es super. Wo ist die revolutionäre Energie? Wo ist die Linke, die Mobil macht! Wo sind die Radikalen?“ Wir klären auch diese Sehnsucht noch einstimmig, denn dass sie den radikalen linken Block ablehnen, mit seiner hanebüchenen „Weg-mit-dem-Staat!“ und „Nie-wieder-Deutschland!“ – Rhetorik, das ist ihnen auch klar. Aber es schmerzt sie wirklich zu sehen, was in ihrem Ostdeutschland, ihrem Sachsen so los ist heutzutage und das ist ein Schulterschluss zwischen mir und ihnen, Generationengraben hin oder her. Sie müssen leider aufbrechen, ihr Boot legt demnächst ab. Ich hätte gut und gerne den Rest des Tages mit ihnen unter einem dieser Schirme sitzen und reden wollen. Parolen hätte ich mit ihnen angestimmt und versucht, irgendwo etwas zum Rauchen aufzutreiben, um unseren vielleicht albernen aber herzlichen Bund dadurch zu vertiefen. Jetzt gehen sie und winken und ich denke, hoffentlich bis bald, Genossen.
Wir trinken aus und erreichen pünktlich ein Boot, dass uns vier Kilometer weiter bis zur Rudelsburg mitnimmt. Mein Freund leidet, es ist heiß, Füße und Schultern drücken und er hat im Biergarten zuvor auf ein zweites Bier bestanden, das seine Muskeln sehr, wahrscheinlich zu sehr, entspannt hat. Mit gequältem Gesicht schiebt er sich mit mir über die Wege – ausgerechnet hier liegen die steilsten Aufstiege der Tour vor uns. In wundervoller Höhe laufen wir parallel zur Saale entlang, die Sonne brutzelt, wir genießen ein herrliches Panorama und können uns beim rot und braun werden zusehen. Wir erreichen die Gaststätte „Himmelreich“ mit grandioser Aussicht und essen Pommes mit Apfelschorle für jeweils acht Euro. Beim Verlassen der Gaststätte muss eine Frau inbrünstig lachen, als sie uns erblickt. Sie geht leicht in die Knie, klopft sich auf die Schenkel und ruft „Rübezal!“
Mein Freund geht nun auf dem sprichwörtlichen Zahnfleisch, jede Wegangabe legt er auf die Goldwaage und wird zunehmend gereizter, wenn eine Angabe variiert und der Weg plötzlich wieder zweihundert Meter länger zu sein scheint. Ein Brautpaar befindet sich auf einer herrlichen Lichtung inmitten eines Fotoshooting mit zwei Fotografen. Heiraten in Deutschland, es wird, nein, es ist wieder modern und beliebt. Die Inszenierung des Paares, der Feier, des Brimboriums hat an Bedeutung gewonnen. Wenn es so aussieht wie hier auf dieser Lichtung, kann man es verstehen und möchte umgehend Ringe verschenken – Limelight, Werbeästhetik, zwei herrlich attraktive Menschen am vermeintlich schönsten Tag ihres Lebens. Wir laufen durch einen Heiratswerbespot.
Endlich erscheint Bad Sulza vor uns. Wir sind nun in Thüringen und die ersten Menschen, die wir fragen wo wir eine Pension oder ein Hotel finden können – bitte ohne Umwege, wir leiden – sind nicht nur extrem kompetent sondern auch wahnsinnig freundlich. Auch wenn dies wenig über ein ganzes Bundesland aussagen kann, so ist dies für mich ein gutes Omen, ähnlich wie beim Übertreten der Grenze von Sachsen nach Sachsen-Anhalt.
Die ersten beiden Pensionen sind ausgebucht. Wer hätte das gedacht? Berliner und Leipziger Kennzeichen an den Autos vor den Herbergen, hierhin fahren also die Städter, wenn sie entspannen wollen.
Bad Sulzas Flaggschiff ist ein Thermenkomplex mit zwei angeschlossenen und integrierten Hotels. Wir versuchen unser Glück, die Zeit drängt mittlerweile, denn es wird dunkel und die Laune meines Freundes ist belegt von Schmerzen, die ihn etwas unleidlich machen. Wir stehen am Empfangsschalter der Therme und sehen aus und riechen, wie wir eben aussehen und riechen. Das Hotel ist durch zahlreiche Gänge mit dem Schwimmbad verbunden und somit watscheln um uns herum ausnahmslos Menschen in Badeanzügen und -latschen gen Wellnessbereich und Solebecken. Wir genehmigen uns hier ein Doppelzimmer, welches den Eintritt für Schwimmbad und Sauna beinhaltet. Schnell ziehen wir uns um und laufen mehr oder weniger nackt durch die endlos langen Hotelflure bis zum Schwimmbad. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mit dieser Stimmung soll uns heute auch weitestgehend alles egal sein. Auch hier sind wir wieder Fremdkörper, alles ist auf Relaxen und Entspannung ausgelegt, dazu in der Regel doppelt so alt wie wir und, ja, etwas bieder. Mit entsprechenden Blicken werden unsere Bärte, die Tattoos meines Freundes, der ganze Auftritt und womöglich auch unser Schnack beäugt. Ebenso beäugend stehen wir vor dieser blendend weißen Erholungswelt – stinkend, verschmutzt, humpelnd – aufgeschlagen wie aus einer anderen Welt. Das Ungeheuer von Wellness, wir wollen es hier mit eigenen Augen sehen.
–

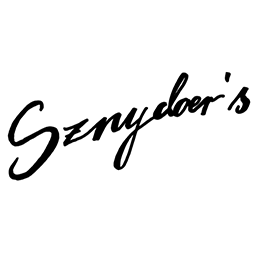



Leave a Reply